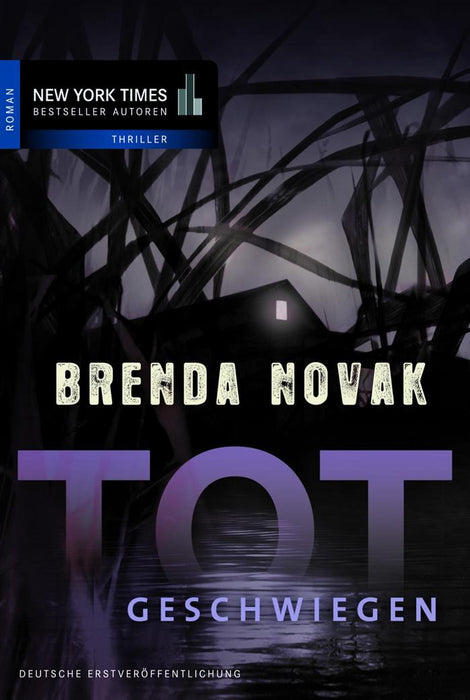Brenda Novak
Totgeschwiegen
Roman
“Die glücklichsten Frauen haben,
wie auch die glücklichsten Nationen,
keine Geschichte.”
– George Eliot –
(englische Schriftstellerin, 1819 – 1880)
1. KAPITEL
Grace Montgomery hielt am Rand des Feldwegs an und sah hinüber zum großen Farmhaus. Dort hatte sie ihre Kindheit verbracht. Sogar in dieser bedeckten Nacht konnte sie im blassen Licht des Halbmondes erkennen, dass ihr älterer Bruder den Hof gut in Schuss hielt.
Aber das war bloß der äußere Schein. Die Wahrheit lag im Verborgenen. So war es auch im Fall dieser hübschen kleinen Südstaatenidylle. Deshalb hatte sie sich eigentlich geschworen, nie mehr hierher zurückzukommen.
Das Licht im ersten Stock erlosch. Clay ging zu Bett, wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie jeden Abend. Grace verstand nicht, wie er es ganz allein hier draußen aushielt. Wie konnte er hier essen, schlafen und arbeiten – nur vierzig Schritte entfernt von der Stelle, an der sie ihren Stiefvater verscharrt hatten?
Sie stieg aus ihrem kleinen BMW. Das Warnsignal ertönte, weil sie den Schlüssel im Zündschloss hatte stecken lassen. Eigentlich hatte sie gar nicht vorgehabt, das Grundstück zu betreten. Aber jetzt war sie hier, und sie fühlte sich auch nach all den Jahren noch immer zu diesem Ort hingezogen.
Sie ging die Auffahrt entlang. Der kühle Stoff ihres Baumwollrocks strich über ihre Beine. Es war windstill. Bis auf das Zirpen der Grillen, das Quaken der Frösche und das Knirschen ihrer Sandalen auf dem Kiesweg war nichts zu hören. Sie hatte ganz vergessen, wie ruhig die Nächte in dieser Gegend waren und wie hell die Sterne hier draußen leuchteten, fernab der Stadt.
Sie erinnerte sich, wie sie als kleines Mädchen mit ihrer jüngeren Schwester Molly und ihrer älteren Stiefschwester Madeline auf der Wiese vor dem Haus geschlafen hatte. Das waren ganz besondere Abende. Sie hatten geplaudert, gelacht und gemeinsam in den tiefschwarzen Himmel geschaut, wo die Sterne ihnen zugeblinzelt und versprochen hatten, ihre Wünsche zu erfüllen. Damals waren sie noch so unschuldig: Wenn Madeline da war, kannte Grace keine Angst. Aber sie konnte natürlich nicht die ganze Zeit bei ihr sein. Sie hatte ja keine Ahnung, was damals in Grace vorgegangen war. Und an dem Abend, als es passierte, war sie gar nicht zu Hause.
Obwohl es sehr warm war, lief Grace ein Schauer über den Rücken, als sie die alte Scheune erreichte. Sie lag auf der rechten Seite zwischen den Trauerweiden und Pappeln. Sie hasste dieses alte Gebäude und die Erinnerungen, die es in ihr wachrief. Dort drinnen hatte sie den Stall des Pferdes ausgemistet, das nur ihr Stiefvater reiten durfte. Dort drinnen hatte sie nach Eiern gesucht und sich mit dem verrückten Hahn herumgeschlagen, der immer wieder hochflatterte, um ihr die Augen auszukratzen. Dort drinnen, im vorderen Teil der Scheune, hatte ihr Stiefvater, der Reverend, sich ein kleines Büro eingerichtet, in dem er seine Sonntagspredigten schrieb.
Der Geruch nach feuchter Erde und Magnolien brachte die Erinnerung zurück. Grace brach kalter Schweiß aus. Sie ballte die Fäuste so heftig, dass ihre Fingernägel sich tief in die Haut gruben. Du bist kein kleines Mädchen mehr, sagte sie sich verzweifelt. Es ist vorbei!
Sie versuchte, an etwas anderes zu denken. Sie musste die Erinnerung an dieses schreckliche kleine Kabuff unbedingt loswerden. Doch sie konnte nicht vergessen.
Das enge Zimmer war bis heute unberührt. Alles war so geblieben, wie er es hinterlassen hatte. Alles schien auf seine Rückkehr zu warten. Ihre Mutter hatte darauf bestanden, nichts zu verändern. Von Reverend Lee Barker sprachen sie weiterhin in der Gegenwart. Die Leute in der Stadt waren schon misstrauisch genug.
Die Einwohner von Stillwater, einer kleinen Gemeinde im Staat Mississippi, hatten ein gutes Gedächtnis. Würden sie es achtzehn Jahre nach dem Verschwinden des Reverends akzeptieren, wenn Clay das Büro ausräumte?
“Runter von meinem Grundstück, oder ich schieße!”, ertönte plötzlich eine tiefe Stimme.
Grace wirbelte herum. Ihr gegenüber stand ein über ein Meter neunzig großer, kräftiger Mann, der aussah wie aus Stein gemeißelt. Es war ihr Bruder. Und er zielte mit dem Gewehr auf sie.
Einen kurzen Moment lang wünschte Grace, er würde schießen.
Aber dann musste sie lächeln. Clay war auch früher schon immer wachsam. Er war der große Bruder. Er passte auf alle auf.
“Hey! Erkennst du deine eigene Schwester nicht mehr?”, sagte sie und trat aus dem Schatten.
“Grace?” Der Gewehrlauf senkte sich, und ihr Bruder machte eine unbeholfene Bewegung. Er wollte sie umarmen. Aber obwohl Grace ebenso danach zumute war, ging sie keinen Schritt auf ihn zu. Ihre Beziehung war viel zu … kompliziert.
“Grace! Du bist seit dreizehn Jahren weg! Ich erkenne dich kaum wieder! Du bist wirklich unvorsichtig. Ich hätte dich glatt über den Haufen schießen können”, fügte er grimmig hinzu.
Und wenn schon, dachte sie. Wie schnell es doch gehen könnte. Es bräuchte nur eine einzige Kugel …
“Wirklich?”, murmelt sie stattdessen. “Ich hab dich sofort wiedererkannt.” Vielleicht, weil sie so oft an ihn gedacht hatte. Abgesehen davon hatte er sich wirklich nicht sehr verändert. Sein dichtes Haar war immer noch schwarz – dunkler noch als Grace’ eigene Haare – und fiel ihm widerspenstig in die Stirn. Seine ernsten dunklen Augen, die ihren eigenen so sehr ähnelten, seine ausgeprägten Wangenknochen, seine Muskeln, die seither noch kräftiger geworden waren. Neben ihm fühlte sie sich mit ihren ein Meter fünfundsechzig und den fünfundfünfzig Kilo Gewicht ziemlich klein. Aber abgesehen davon ähnelten sie einander sehr.
“Ich dachte, du schläfst schon”, sagte sie.
“Ich habe dein Auto kommen sehen.”
“Immer auf der Hut.”
Falls er den ironischen Unterton in ihrer Stimme bemerkt haben sollte, reagierte er jedenfalls nicht darauf. Aber er warf einen kurzen Blick auf die alten Bäume, unter denen sich das Grab ihres Stiefvaters befand.
Nach einem peinlichen Moment des Schweigens sagte er: “Das Leben in Jackson scheint dir zu bekommen. Du siehst gut aus.”
Sie war tatsächlich gut zurechtgekommen in der großen Stadt. Jedenfalls bis zu dem Moment, als George E. Dunagan ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Als er das zum dritten Mal tat und sie sich immer noch nicht zu einem Ja entschließen konnte, war ihre Beziehung zerbrochen. Dabei wünschte sie sich nichts sehnlicher, als mit ihm zusammen zu sein. Und weil er das wusste, hatte er ihr nach seinem letzten Antrag zu verstehen gegeben, dass er sie erst wiedersehen wollte, wenn sie eine Therapie hinter sich gebracht hatte. Sie sollte die Probleme lösen, die in ihrer Kindheit begründet lagen.
Sie ging tatsächlich zu einer Therapeutin, doch das brachte nichts. Es gab einfach viel zu viele Themen, über die Grace nicht reden wollte oder konnte – nicht einer Therapeutin und auch nicht George gegenüber. Und obwohl er dann einlenkte und sie wieder anrief, standen Grace’ Probleme weiterhin zwischen ihnen.
Sie hoffte inständig, dass es damit bald vorbei sein würde. Sie hatte sich vorgenommen zu handeln. Entweder würde sie die Vergangenheit besiegen oder die Vergangenheit würde sie besiegen. Der Ausgang war offen, das Ergebnis unsicher, aber sie würde erst dann nach Jackson zurückkehren, wenn sie mit Stillwater ins Reine gekommen war.
“Ich komme ganz gut zurecht.”
“Mom hat erzählt, dass du auf der Uni die Beste deines Jahrgangs warst.”
Das war jetzt sechs Jahre her … Sie lächelte unbestimmt. Es schien ihn zu beeindrucken. Sie selbst war nie sehr lange mit dem zufrieden, was sie erreicht hatte. “Ist schon erstaunlich, was man alles schaffen kann, wenn man sich ganz auf sich selbst konzentriert.”
“Und du hast dir natürlich die tollste Uni ausgesucht”, stellte er fest.
Zwei Tage nach ihrem Abschluss an der Highschool in Stillwater hatte sie ihre Heimatstadt verlassen und als Kellnerin in einem Imbiss in Jackson angefangen. Nebenbei hatte sie zwei Jahre lang jede freie Minuten genutzt, um für ihre Aufnahmeprüfung zu lernen. Als sie dann ein regelrechtes Traumergebnis bei der Prüfung erzielte, schien sich niemand mehr für ihren Notendurchschnitt im Schulabschlusszeugnis zu interessieren. Zunächst studierte sie an der University of Iowa und konnte schließlich einen der begehrten Studienplätze an der Georgetown University ergattern.
Aber warum sollte sie all das hier und jetzt mit ihrem Bruder Clay diskutieren? Sie dachte nicht oft an das College zurück. Damals hatte sie nur drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen. Alle anderen hatten es irgendwie geschafft, das Studium und ihr Privatleben einigermaßen zu vereinbaren, Grace hingegen lernte die ganze Zeit. Sie wollte einen guten Abschluss machen, und dafür musste alles andere zurückstehen.
Sie hatte versucht, ihre Vergangenheit zu bewältigen, indem sie besser war als alle anderen. Aber nachdem sie die Universität hinter sich gelassen und fünf Jahre lang im Büro des Bezirksstaatsanwalts gearbeitet hatte, war ihr klar geworden, dass es einfach nicht möglich war, vor den eigenen Problemen wegzulaufen. Dennoch konnte sie immer noch kein ganz normales Leben führen.
“Ich hatte eben Glück”, sagte sie schlicht.
Er warf einen Blick zum Haus. “Kommst du mit rein?”
Sie vernahm den hoffnungsvollen Unterton in seiner Stimme und warf einen Blick zur Veranda, auf deren Stufen sie früher immer gesessen hatten, wenn ihre Mutter ihnen aus der Bibel vorlas. Reverend Barker hatte darauf bestanden, dass sie sich jeden Abend eine Stunde lang mit der Bibel beschäftigten. Es war sicherlich keine schlechte Erfahrung. Die kleine Grace hatte mit einem Glas Limonade in der Hand dagesessen und gespürt, wie die Sommerhitze sich langsam abschwächte. Sie lauschte der melodischen Stimme ihrer Mutter, während der Schaukelstuhl auf den knarrenden Dielen hin- und herwippte und die Mücken im Licht der Laterne tanzten. Sie hatte diese Abende geliebt. Bis ihr Stiefvater nach Hause kam.
“Nein, ich … ich muss weiter.” Sie trat ein paar Schritte zur Seite. Clay war noch immer auf der Hut, genau wie früher. Sie wusste, sie würde keine weiteren Erinnerungen mehr verkraften.
“Wie lange bleibst du?”
Sie zögerte, bevor sie antwortete. “Ich weiß nicht.”
Er verzog das Gesicht und sah jetzt sehr rau aus. Ganz offensichtlich machte das Familiengeheimnis auch ihm arg zu schaffen. “Warum bist du zurückgekommen?”, fragte er.
Sie kniff die Augen zusammen. “Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre zu erzählen, was damals passiert ist.”
“Woher willst du wissen, dass das besser wäre?”
“Weil ich seit fünf Jahren nach den Wahrheiten im Leben anderer Menschen suche und die Leute auffordere, Verantwortung zu übernehmen.”
“Und bist du sicher, dass du immer den richtigen Täter findest und er eine angemessene Strafe bekommt?”
“Wir müssen in unser Rechtssystem vertrauen, Clay. Sonst fällt die ganze Gesellschaft auseinander.”
“Und wer soll für das einstehen, was hier passiert ist?”
Für den Mann, dessen Leiche wenige Meter entfernt begraben lag.
“Warum bist du nicht schon früher gekommen?”
“Aus dem gleichen Grund, der dich dazu bringt, noch immer mit einem Gewehr in der Hand über diesen Ort zu wachen.”
Er musterte sie einige Sekunden lang. “Klingt so, als müsstest du eine schwerwiegende Entscheidung treffen.”
“Ja. So ist es wohl.”
Keine Antwort.
“Willst du nicht versuchen, mich davon abzubringen?”, fragte sie mit einem unfrohen Lachen.
“Tut mir leid. Diese Entscheidung musst du schon alleine fällen.”
Sie hasste diese Antwort, und beinahe hätte sie es ihm gesagt. Am liebsten hätte sie jetzt einen Streit vom Zaun gebrochen, doch Clay wechselte das Thema, bevor sie noch etwas sagen konnte.
“Hast du gekündigt?”, fragte er.
“Nein, ich habe mir freigenommen.” Sie hatte in fünf Jahren kein einziges Mal gefehlt. Sie hatte zwei Monate Urlaub angespart, und wenn der verbraucht war, konnte sie immer noch unbezahlten Sonderurlaub nehmen.
“Da hast du dir ja einen interessanten Ort ausgesucht für deine Ferien.”
“Du bist schließlich auch hier.”
“Ich habe gute Gründe.”
Er nahm ihr nicht übel, dass sie gegangen war. Sie spürte seine Erleichterung darüber, dass sie all dem entronnen war. Es wäre ihm lieber gewesen, sie wäre weggeblieben und hätte ihn, Stillwater und alles andere vergessen.
Seine Rücksicht machte ihr zu schaffen, denn genau das wünschte sie sich auch. “Du könntest doch auch hier weg”, murmelte sie, obwohl sie wusste, dass das nicht stimmte.
Er kniff die Lippen zusammen und presste hervor: “Ich habe meine Entscheidung getroffen.”
“Du bist wirklich furchtbar störrisch”, sagte sie. “Wahrscheinlich wirst du dein ganzes Leben hier verbringen.”
“Wo bist du untergekommen?”, fragte er.
“Ich hab das Haus von Evonne gemietet.”
“Dann weißt du es also schon.”
Grace spürte den Schmerz in ihrer Brust. “Molly hat mich angerufen, als sie starb.”
“Molly war auch bei ihrer Beerdigung.”
“Molly findet immer wieder Gründe, hierherzukommen”, verteidigte sie sich, obwohl er sie gar nicht angegriffen hatte. Sie hätte sich gern genauso verhalten wie ihre Schwester. Molly kam und ging und benahm sich so, als wäre nie etwas geschehen. Aber Grace konnte die Widersprüche nicht ertragen. “Ich habe mitten in einer wichtigen Gerichtsverhandlung gesteckt.” Das war nicht gelogen. Aber sie wäre auch nicht gekommen, wenn es ihr möglich gewesen wäre. Vor drei Monaten noch hatte sie das kategorisch abgelehnt. Sie wäre höchstens zum Begräbnis ihrer Mutter angereist – und sogar da war sie sich nicht sicher.
“Ich weiß, dass Evonne dir sehr viel bedeutet hat”, sagte er. “Sie war ein guter Mensch.”
Evonne Walker hatte in allem nur das Gute gesehen. Als Grace Stillwater verlassen hatte, war die kinderlose Witwe fünfundsechzig Jahre alt. Sie hatte früher Tag für Tag und bei jedem Wetter unter der Markise in ihrem Vorgarten gesessen und dort hausgemachte Seifen und Lotionen verkauft, Kräuter aus dem eigenen Garten, eingemachtes Gemüse, Pfirsiche und Tomaten, Püree aus Süßkartoffeln und Schokoladenkuchen.
Evonne war eine besondere Frau, und zwar aus drei Gründen: Sie hatte den Reverend nicht ausstehen können, sie hatte sich immer nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert und, sie war stets sehr nett zu Grace.
Etwa eine Woche nach Evonnes Begräbnis hatte ein Anwaltsbüro Grace ein Päckchen geschickt. Das war der letzte Anstoß, doch noch einmal nach Stillwater zurückzukehren – zusätzlich zu Georges Drängen, sich endlich den Problemen zu stellen, die ihrer Hochzeit im Weg standen. Auch wenn George jetzt wieder mit ihr sprach, war die Sache nicht vom Tisch. Er hatte ihr ein Ultimatum gestellt. In drei Monaten musste sie mit ihrer Vergangenheit zurande gekommen sein. Er wollte nicht sein Leben lang auf etwas warten, was womöglich nie geschehen würde.
Clay nahm das Gewehr in die andere Hand, als wäre ihm gerade erst wieder bewusst geworden, dass er es immer noch bei sich trug. “Die Leute hier denken, sie hat ihre Rezepte mit ins Grab genommen.”
“Nein.” Sie waren Evonnes Abschiedsgeschenk, das einzige Geschenk, das Grace jemals von ihr bekommen hatte.
“Wahrscheinlich hat sie sie dir vermacht, weil du ihr immer geholfen hast”, sagte er.
Aber Grace glaubte eher, dass Evonne eine Ahnung gehabt hatte, was damals vorgefallen war.
Trauer und Schuldgefühle vermischten sich mit Bedauern und Verwirrung. Grace spürte einen dicken Kloß im Hals. Sie konnte kaum noch sprechen: “Es ist alles so schrecklich kompliziert, Clay.”
“So ist es wohl”, stimmte er zu.
Sie wandte sich wieder ihrem Auto zu. “Es ist schon spät. Ich gehe jetzt lieber.”
“Warte.” Er fasste nach ihrem Handgelenk, ließ es aber sofort wieder los, als fürchtete er, sie könnte Angst vor ihm bekommen. “Es tut mir leid, Grace, das weißt du doch?”
Sie konnte den gepeinigten Ausdruck auf seinem Gesicht nicht ertragen. Es war ihr viel lieber, wenn er unbeteiligt dreinblickte. Sie wollte nichts von seinen inneren Qualen wissen. Das nicht auch noch.
“Ich weiß”, sagte sie leise und ging davon.
Diese Entscheidung musst du alleine fällen …
Immer wieder ging Clays Satz ihr im Kopf herum. Meinte er damit, dass er es ihr nicht verübeln würde, wenn sie ihr Schicksal selbst in die Hand nahm? Er hatte nichts von den zweifellos sehr ernsten Konsequenzen gesagt oder davon gesprochen, dass einige Menschen tief verletzt werden könnten. Er hatte ganz einfach die Verantwortung an sie zurückgegeben.
Sie liebte und hasste ihn dafür.
Wie sehr sie sich danach sehnte, ihm einmal ganz offen zu begegnen …
Es klingelte. Sie schob die Kiste beiseite, die sie gerade auspacken wollte, stand auf und ging über den Holzfußboden zur Haustür. Evonnes Verwandte hatten die meisten Möbel abgeholt. Sie wollten sie bei einer Auktion verkaufen. Trotzdem hatte Grace bei Rex Peters, dem Immobilienmakler, angerufen und das Haus gemietet. Sie wollte retten, was noch zu retten war: das Geschirr, die Küchengeräte, ein paar alte Möbelstücke, Gartengeräte und ein paar Fotos. Nun wartete sie auf George, der ihr ein Bett, ein paar Schränke, ein Sofa, Stühle und eine Essecke aus ihrer Wohnung in Jackson bringen sollte. Sie würde drei Monate in Stillwater bleiben – mehr Zeit hatte sie nicht, um “wieder in Einklang mit der Familie zu kommen”, wie George es ausgedrückt hatte. Währenddessen wollte sie nicht in einem halb leeren Haus wohnen.
Einen Augenblick lang hoffte sie, George würde es so eilig haben, dass er gleich wieder abfuhr. Seit der halbherzigen Versöhnung war ihre Beziehung angespannt, und obwohl sie sich eigentlich freuen sollte, ein bekanntes Gesicht zu sehen, wollte sich dieses Gefühl nicht einstellen. Sie litt darunter, dass er etwas von ihr verlangte, das sie ihm nicht geben konnte. Und sie fürchtete sich davor, wieder mit ihm ins Bett zu gehen. Das war das größte Problem von allen.
Wieder klingelte es.
Offenbar hatte er wirklich keine Zeit …
“Ich komme!” Sie riss die Tür auf. Aber da stand nicht George, sondern ein Junge mit grauen Augen, Sommersprossen im Gesicht und wirren blonden Haaren, die nur mühsam von einer Baseballmütze im Zaum gehalten wurden.
“Oh, hallo”, sagte sie überrascht.
Er sah zu ihr auf und sagte: “Tag.”
Sie wartete, aber mehr kam nicht.
“Was kann ich für dich tun?”
“Soll ich den Rasen mähen? Für fünf Dollar?”
Grace blickte ihn erstaunt an. “Bist du denn schon alt genug, um ganz allein einen Rasenmäher zu bedienen?”
So wie er sie jetzt ansah, war klar, dass er Zweifel an seinen Fähigkeiten nicht zu schätzen wusste. “Für Evonne hab ich den Rasen auch gemäht”, sagte er beleidigt.
Jahrelang war Grace Tag für Tag mit dem Fahrrad zu Evonne gekommen und hatte für sie kleine Aufträge erledigt. Wahrscheinlich hätte sie all das auch sehr gut allein erledigen können, aber auf diese Weise konnte sie Grace regelmäßig etwas zustecken, ein paar Pfirsiche oder ein Glas mit eingelegtem Gemüse oder dann und wann auch ein paar Dollar.
Grace’ Familie hatte jeden Cent gebrauchen können. Vor allem, nachdem Irene beschlossen hatte, Clay aufs College zu schicken.
“Ich spare nämlich”, fügte der Junge hinzu.
Grace lächelte ihn an. “Worauf denn?”
Er zögerte. “Das ist noch geheim.”
“Oh.” Sie musterte ihn. Er trug schmutzige Turnschuhe, Bluejeans, die an den Knien durchgescheuert waren, und ein übergroßes T-Shirt. Er sah ziemlich schmuddelig aus, aber wahrscheinlich hatte er sich heute Morgen alles ganz frisch angezogen. Es war nicht möglich, von seinem Erscheinungsbild darauf zu schließen, ob sich jemand gut um ihn kümmerte oder nicht. “Wie alt bist du denn?”, fragte sie.
“Acht.”
Jünger, als sie gedacht hatte, er sah eher aus wie neun. “Wohnst du in der Nachbarschaft?”
Er nickte.
“Ich verstehe. Tja. Da sich niemand aus Evonnes Familie um den Rasen kümmert, musst du das jetzt wohl tun.”
Anstatt sie nun anzustrahlen, wie sie es erwartete, drehte er sich nun um und begutachtete den Garten. Dann kratzte er sich am Haaransatz unter seiner Kappe, als wäre er schon zwanzig Jahre älter, und fragte: “Soll ich gleich damit anfangen?”
“Das Gras ist noch ziemlich kurz.”
Er dachte nach. Es passte ihm gar nicht, dass er eine so gute Gelegenheit verpasst hatte. “Ich könnte auch Unkraut jäten.”
“Für fünf Dollar?”
“Aber nicht, wenn ich auch noch den Garten hinterm Haus machen muss.”
Dieser Teil des Gartens war wirklich sehr weitläufig und ziemlich vernachlässigt. “Wie wär’s, wenn du dir nur die Beete vornimmst?”
“Krieg ich dann auch noch einen Keks dazu?”
Sie hätte am liebsten laut losgelacht, riss sich aber zusammen. Wenn sie ihn nicht ernst nahm, war er wahrscheinlich tödlich beleidigt. “Du verhandelst ja ganz schön hart.”
“Ist doch nur ein Keks.”
“Aber ich bin gerade erst eingezogen. Ich habe keine Kekse.”
Er dachte nach. “Vielleicht haben Sie morgen ja welche?”
“Wenn du mir Kredit gibst.”
“Klar.” Zum ersten Mal lächelte er. Zwei seiner Schneidezähne fehlten. “Ein Keks morgen ist besser als nichts. Vielleicht geben Sie mir ja sogar zwei. Weil ich so lange warten musste.”
Er war eindeutig ein aufgeweckter Bursche. “Wie heißt du?”, fragte sie lächelnd, als sie sein schlaues Grinsen bemerkte.
“Teddy.”
“Ich bin Grace. Ich schätze, wir haben jetzt eine Abmachung.”
“Vielen Dank!” Er rannte zum Blumenbeet und begann in Windeseile, Unkraut herauszuzupfen. Genau in diesem Moment kam ein Lieferwagen die Straße entlang. Es war George in einem gemieteten Transporter.
Er lächelte und winkte, als er sie sah. Dann parkte er ein.
“Das ist ja ein tolles Haus”, stellte er fest, nachdem er ausgestiegen war.
Sie dirigierte ihn Richtung Eingang. “Es ist alt, aber ich mag diese hohen Räume und die großen Fenster, die schnörkelige Tapete und den Holzfußboden. Das ist alles … so wie sie war, weißt du? Wenn ich die Augen zumache, rieche ich die Kräuter, die sie immer benutzt hat. Es ist fast so, als wäre sie noch da.”
“Von wem sprichst du?”
“Von Evonne.”
“Ist das nicht die Frau, die kürzlich gestorben ist? Die immer ihre Sachen im Vorgarten verkauft hat?”
Grace nickte und hielt ihm die Tür auf.
“Wie bist du denn an ihr Haus gekommen?”
“Das hab ich dir doch schon am Telefon erzählt.”
“Tut mir leid. Ich hatte so schrecklich viel mit dem Wrigley-Fall zu tun, ich hab’s nicht richtig mitbekommen.”
Sie schloss die Tür hinter ihm. “Dieser Einbruch mit anschließender Vergewaltigung?”
“Ja.” Der Rechtsanwalt nickte.
“Das ist ja auch eine vertrackte Geschichte”, gab sie zu, aber eigentlich wollte sie nichts davon hören. Sie hatte die Beweislage studiert und wusste, dass der Klient, ein dreißigjähriger Maurer, ein gefährlicher Gewalttäter war. Es gefiel ihr gar nicht, dass George alles daransetzte, diesen Kerl freizubekommen.
“Das stimmt. Aber jetzt erzähl mir doch noch mal, wie du an dieses Haus gekommen bist. Du scheinst es ja sehr zu mögen.”
“Ich war einfach nur zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Evonnes Familie will es verkaufen, aber ich habe sie überredet, es mir für drei Monate zu überlassen, bevor sie es anbieten.”
“Du willst dich hier doch hoffentlich nicht niederlassen?”, fragte er.
“In Stillwater?”, fragte sie ungläubig. Erst drängte er sie hierherzukommen, um mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen, und dann gefiel ihm nicht, dass sie seinen Rat befolgte?
“Stimmt ja.” Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht und strich sich mit der Hand über sein schon etwas lichter gewordenes Haar. “Das willst du sicher nicht. Du hasst dieses Städtchen ja.”
So hätte sie es nicht ausgedrückt. Aber George war in einer wohlhabenden Familie groß geworden, von hingebungsvollen Eltern erzogen und von seiner jüngeren Schwester abgöttisch geliebt worden. Er konnte nicht verstehen, wie kompliziert ihre Kindheit und Jugend gewesen waren. Er hatte keine Ahnung, wie es sich anfühlte, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller hatte.
“Ich mag diese ländliche Gegend schon. Hier geht alles seinen Gang. Alles ist nett und gemütlich”, sagte sie, während er seinen Blick umherschweifen ließ. Es waren die Erinnerungen an früher, die sie quälten. Und heute außerdem auch die enorme Hitze. Aber in Jackson waren die Sommer auch nicht wesentlich angenehmer.
“Du hast recht. Dieses Haus hat wirklich was Altehrwürdiges an sich”, stellte er fest.
“Komm mit in die Küche. Du hast bestimmt Durst.”
Er warf einen Blick in den Garten. “Wer ist denn das?”
Teddy kniete am Rand eines Beetes und begutachtete den Neuankömmling kritisch, dann jätete er weiter.
“Ein Junge aus der Nachbarschaft.”
“Hübscher Kerl. Gut, dass er nicht schon zwanzig Jahre älter ist. Sonst würde ich mir Sorgen machen, dass er mir dich wegschnappt.”
Grace hielt inne. Ihr war klar, dass George auf diese Weise ein Zeichen von ihr bekommen wollte, ein Zeichen, dass er hoffen konnte. Aber so einfach war das nicht. Natürlich mochte sie ihn sehr gern. Obwohl er sie eigentlich nicht wirklich verstand, war er immer ein aufopferungsvoller Freund. Und wenn die Wunden in ihrem Herzen verheilt waren, würde sie ihn heiraten und eine Familie mit ihm gründen.
“Ich laufe dir schon nicht davon”, sagte sie schließlich.
Er nahm ihre Hand, beugte sich herab und küsste sie auf die Stirn. “Dann bin ich ja beruhigt. Und wenn du wieder zu Hause bist, nehmen wir die Zukunft in Angriff.”
Es war typisch für ihn, dass er sie auf diese Weise ermutigen wollte. Er wusste ja nicht, wie es sich anfühlte, wenn man tief im Innersten verletzt worden war. Ihm genügte es, wenn sie einfach nur zu allem Ja sagte.
“So machen wir es”, stimmte sie zu, um sein Vertrauen in sie nicht zu erschüttern.
Er sah sie skeptisch an, aber dann küsste er sie.
Grace schlang ihre Arme um seinen Nacken und gab sich seinem Kuss hin, bis er intensiver wurde und sie den Widerwillen verspürte, der sie in solchen Situationen immer wieder erfasste. Sie schob ihn zurück und lächelte dabei, um ihre Panik zu überspielen. “Ich mach dir was zu trinken, okay?”
“Gern.” Er folgte ihr, vorbei an den wenigen Kisten, die sie in ihrem eigenen Auto nach Stillwater mitgebracht hatte. “Und was hast du so vor, ganz allein in der kleinen Stadt?”, fragte er.
“Das habe ich mich auch schon gefragt.”
“Wie wär’s, wenn du meine Kanzlei hier vertrittst?”
Sie schaute ihn skeptisch an. “Du willst doch nicht etwa deine Klienten hintergehen, indem du einer Staatsanwältin Zugang zu ihren Akten ermöglichst?”
“Ach komm schon, Grace, das darfst du nicht so eng sehen. Du bist drei Monate freigestellt. Du wirst keinen dieser Fälle bearbeiten.”
Es war trotzdem nicht koscher. Außerdem hatte Grace keine Lust dazu. “Danke, lieber nicht. Ich habe meinen Computer zu Hause gelassen, weil ich eine Zeit lang überhaupt nichts mit meinem Job zu tun haben möchte.” Sie wollte den Dämonen ihrer Vergangenheit die Stirn bieten, da konnte sie sich nicht von beruflichen Dingen ablenken lassen.
“Was willst du denn dann tun?”
In der Küche standen altertümliche Schränke und Regale mit bunten Verzierungen. Eigentlich ist klar, was man hier tun muss, dachte sie. “Ich werde die Rezepte ausprobieren, die Evonne mir vermacht hat.”
Das schien ihm gar nicht zu gefallen. “Du willst Seifen herstellen?”
“Genau”, sagte sie und holte eine Karaffe Eistee mit Himbeergeschmack aus dem Kühlschrank, um ihm ein Glas einzuschenken.
“Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen”, scherzte er.
Grace reichte ihm das Glas. “Wie meinst du das?”
“Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass eine so talentierte Staatsanwältin wie du sich auf die Veranda setzt, um hausgemachte Spezialitäten zu verkaufen. Lange wirst du das nicht durchhalten.”
Grace strich sich eine widerspenstige Haarsträhne hinters Ohr. Vielleicht war es ja keine große Herausforderung, aber auch nicht so hektisch. In ihrem Beruf war sie ständig damit beschäftigt, das in Ordnung zu bringen, was andere Leute angerichtet hatten – soweit das nach einem Verbrechen überhaupt möglich war. Jetzt wollte sie die Einbrüche, Vergewaltigungen und Morde hinter sich lassen und sich mit den einfachen Dingen des Lebens beschäftigen. “Das wird schon gehen”, erklärte sie zurückhaltend. Sie wollte keinen Streit vom Zaun brechen.
“Danach bist du bestimmt froh, wenn du wieder arbeitest.”
“Gut möglich.”
“Nach einer Woche hast du genug. Wetten?”
Es könnte etwas länger dauern. Grace war nicht gerade erpicht darauf, wieder aufzurühren, was damals auf der Farm geschehen war. Und hier im Haus von Evonne fühlte sie sich so heimisch wie schon lange nicht mehr.
2. KAPITEL
Am nächsten Morgen klingelte Grace’ Handy schon sehr früh. Sie griff eilig danach, um sich zu melden, bevor die Mailbox ansprang; es war sicher jemand aus ihrem Büro.
Erst da wurde ihr bewusst, dass sie sich in Evonnes Schlafzimmer befand. Sie hatte geschlafen wie ein Baby – in ihrem eigenen Bett! Sie hatte es gestern noch mit tatkräftiger Unterstützung von George die Treppe hinaufgeschafft.
Sie war nicht mehr in Jackson, sie war jetzt in Stillwater. Und sie würde eine ganze Weile hier bleiben.
“Mach dir keine Sorgen, George, du wirst mich nicht verlieren”, murmelte sie und drückte auf die grüne Taste. Sicher wollte er sich erkundigen, wie es ihr nach seiner Abfahrt in ihrem neuen Heim ergangen war. Sie war ziemlich erleichtert, dass er wegen seiner Arbeit gleich hatte zurückfahren müssen. So war er wenigstens nicht auf die Idee gekommen, mit ihr zu schlafen.
“Hallo?”
“Du musst Mom anrufen und Madeline.”
Es war ihre jüngere Schwester Molly. Sie arbeitete als Modedesignerin in New York. Als Teenager war sie fast genauso erpicht darauf, Stillwater zu verlassen, wie Grace. Nach der Highschool hatte sie ein Stipendium bekommen und Modedesign in Los Angeles studiert. Seither kam sie nur noch selten in die alte Heimat, um Grace in Jackson oder Clay, Madeline und ihre Mutter Irene in Stillwater zu besuchen.
Grace fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, um wach zu werden. “Warum?”
“Weil sie wissen, dass du in Stillwater bist.”
“Clay hat es ihnen wohl schon erzählt.”
“Soweit ich weiß, bist du gestern Abend bei ihm gewesen. Wie lange sollte er denn warten?”
“Bis ich so weit bin, würde ich sagen.”
“Hast du ihn gebeten, es nicht weiterzusagen?”
“Nein. Ich dachte mir schon, dass er es Mom erzählen würde.”
“Na siehst du.”
Grace unterdrückte ein Gähnen und schob die dünne Bettdecke beiseite. Es war um halb sieben Uhr morgens und schon schwül. Das offene Fenster und der Ventilator, der in einer Zimmerecke vor sich hinschnurrte, nutzten da auch nicht viel. Gegen die Hitze konnte man nicht viel tun, bestenfalls sich in eine Badewanne mit kaltem Wasser setzen. Evonnes Haus hatte keine Klimaanlage. “Okay, ich … ich rufe sie dann nachher an.”
“Wusstest du übrigens, dass Mom einen Freund hat?”, fragte Molly.
Grace’ Müdigkeit verflog schlagartig. “Soll das ein Scherz sein?”
“Nein.”
“Als ich vor ein paar Wochen mit ihr gesprochen habe, hat sie nichts davon erzählt.”
“Das ist eine recht frische Beziehung, falls man es überhaupt so bezeichnen kann. Ich habe am Samstag mit Clay telefoniert, und er hat mir erzählt, dass sie oft weggeht und ein ziemliches Geheimnis daraus macht. Deshalb fragen wir uns, ob sie vielleicht heimlich jemanden trifft.”
“Glaubst du, es ist jemand aus Stillwater?”
“Falls es so ist, kann ich mir nicht vorstellen, wer es sein sollte. Du weißt ja, wie die Leute sie immer behandelt haben.”
“Aber es ist doch nicht mehr so schlimm wie früher, oder?”
“Natürlich nicht. Aber es gibt immer noch viele, die nichts mit ihr zu tun haben wollen.”
“Die Menschen hier sind wirklich entsetzlich misstrauisch und nachtragend.”
Molly ignorierte diesen Kommentar. “Jedenfalls hat sie jemanden gefunden. Und das wurde doch auch Zeit. Wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht hat … Sie verdient es, einen netten Mann um sich zu haben.”
“Und was ist, wenn er nicht nett ist?”
“Irgendwann muss es das Schicksal doch auch mal wieder gut mit uns meinen, findest du nicht? Sie kann doch nicht dreimal hintereinander eine Niete ziehen.”
Da konnte man sich nie sicher sein. Und selbst wenn ihre Mutter einen netten Mann kennengelernt hatte – durfte man ihn mit der Vergangenheit ihrer Familie belasten? Das Schlimmste durfte er natürlich nie erfahren. Das war ja auch ein Problem in ihrem Verhältnis zu George – ihre Unfähigkeit, ihm vollkommen ehrlich gegenüberzutreten. “Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie es noch schlechter treffen könnte als mit unserem Vater und Reverend Barker.”
“Unser Vater war doch gar nicht so schlimm.”
“Aber er ist abgehauen.”
“Das meine ich ja. Er hat einen einzigen großen Fehler begangen, nicht zwei. Und Mom hätte diesen Reverend nie geheiratet, wenn sie nicht so verzweifelt gewesen wäre. Sie wollte doch nur die Familie zusammenhalten.”
“Ich weiß.” Grace warf ihrer Mutter nicht vor, dass sie auf ihren zweiten Ehemann hereingefallen war. Er hatte ihr viel versprochen und sich zu Anfang wie ein solider Partner verhalten, wie einer, der zu seiner Frau hält und die Kinder unterstützt. Er hatte sich nicht davongestohlen wie ihr leiblicher Vater. Niemand hätte sich vorstellen können, welch finstere Seite dieser fromme Mann gehabt hatte.
“Warum hast du mir nichts davon erzählt?”, fragte Molly.
“Wovon?” Grace war furchtbar heiß. Sie zog sich das T-Shirt über den Kopf und setzte sich nur mit einem Slip bekleidet vor den Ventilator. Auf ihrer feuchten Haut fühlte sich der Lufthauch angenehm kühl an.
“Dass du nach Stillwater zurückgehst.”
Grace hatte diese Entscheidung alleine gefällt. Sie wusste, dass Molly ihr gerne beigestanden hätte; sie wollte es immer allen recht machen und versuchte, sich um alle zu kümmern. Grace widerstrebte es, das auszunutzen. “Der Gedanke ist mir eher spontan gekommen”, log sie.
“Kaum zu glauben.”
“Aber es stimmt.”
“Du musstest doch bestimmt eine ganze Menge Dinge in die Wege leiten.”
“Ach was. Das ging alles sehr schnell.”
“Wenn du meinst.” Offensichtlich wollte Molly keinen Streit mit ihr anfangen. “Und wie fühlt es sich an, wieder zurück zu sein?”
Grace ließ sich aufs Bett fallen, starrte zur Decke und suchte nach einer Antwort. Es fiel ihr nicht leicht, hier zu sein, aber in diesem Moment hatte sie das Gefühl, in dieses Haus zu gehören, ins Haus von Evonne. Und dass sie sich nicht hetzen musste und nicht tausend Sachen zu erledigen hatte, fühlte sich auch gut an.
“Es ist ganz nett hier.”
“Wie lange willst du denn bleiben?”
“Ich habe das Haus für drei Monate gemietet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich ausnutzen will.”
“Du solltest unbedingt Mom anrufen.”
“Das wollte ich ja. Ich hatte … zu tun.”
“Das dauert doch nur ein paar Minuten.”
“Bitte dräng mich nicht, Molly.”
“Will ich ja gar nicht. Dafür habe ich im Moment gar keine Zeit. Ich komme noch zu spät zur Arbeit, wenn ich mich jetzt nicht beeile.”
“Dann will ich dich nicht länger aufhalten.”
“Ruf mich an, wenn du was brauchst.”
“Das mache ich”, sagte Grace. Bevor ihre Schwester auflegen konnte, fiel ihr noch etwas ein: “Molly?”
“Ja?”
“Willst du es nicht auch mal versuchen?”
“Was denn?”
“Zurückkommen, Clay besuchen in … unserem alten Haus, mit Madeline zu Abend essen und …”
“Über so etwas denke ich nicht nach”, unterbrach Molly sie.
Wie konnte sie nicht darüber nachdenken? Auch für Grace war es alles andere als einfach. Reverend Lee Barker war zwar tot. Aber obwohl sie mitgeholfen hatte, seine Leiche die Veranda hinunterzutragen, damit Clay sie in eine Schubkarre laden und verscharren konnte, hatte sie noch immer Angst, sie könnte eines Nachts aufwachen und ihren Stiefvater am Fenster entdecken.
“Madeline hofft noch immer, er könnte eines Tages zurückkommen”, fuhr Molly fort. “Aber wir beide wissen, dass er für immer verschwunden ist. Und das ist auch gut so. Die Welt ist besser dadurch geworden.”
“Amen”, stimmte Grace zu. “Aber leider ist sie dadurch nicht einfacher geworden.”
“Du musst die bösen Erinnerungen einfach loslassen.”
War das wirklich so leicht? Wie sollte das denn gehen? “Und was ist, wenn doch noch jemand herausfindet, was wirklich passiert ist? Heutzutage hört man doch ständig von alten Kriminalfällen, die neu aufgerollt werden. Jemand könnte seinen Wagen im Steinbruch finden oder ein Sturm könnte etwas Schreckliches zutage fördern oder ein Zeuge könnte auftauchen …”
“Beruhige dich. Das ist jetzt achtzehn Jahre her. Alles ist in bester Ordnung.”
“Die Leute hier werden das nie vergessen, Molly. Die haben diesen Mistkerl doch wie einen Heiligen verehrt. Sie kannten ihn ja nicht so wie wir.”
“Sie können nicht mal beweisen, dass er tot ist. Und dass man ohne Leiche nur schwer einen Mord beweisen kann, solltest du als Staatsanwältin doch am besten wissen.”
Solltest du doch am besten wissen … Manchmal fand Molly genau die falschen Worte. Dass sie nach all den Jahren immer noch etwas Schreckliches zu verbergen hatten, bewirkte ja eben, dass Grace sich noch immer wie das hilflose Mädchen von damals fühlte und nicht wie die selbstbewusste erwachsene Frau, für die andere sie hielten. “Ich glaube, du solltest jetzt besser zur Arbeit gehen.”
“Wir sprechen später noch mal darüber.”
“Gut.” Grace legte auf und ging zum Fenster, um den Garten zu betrachten. Evonnes Familie schien sich nicht so hingebungsvoll um ihn zu kümmern, wie die Verstorbene es getan hatte, im Gegenteil: Es sah aus, als sei hier seit ihrem Tod überhaupt nichts mehr gemacht worden.
Das würde sich jetzt ändern.
Plötzlich bemerkte sie einen schwarzen Geländewagen in der Seitenstraße direkt hinter dem Zaun des Grundstücks.
“Ups …” Sie hüpfte vom Fenster weg. Hoffentlich hatte der Fahrer sie nicht halb nackt da stehen sehen. Gestern Abend hatte sie ein Tuch vor das Fenster gehängt, es aber mitten in der Nacht wieder weggenommen, damit die Luft besser zirkulieren konnte.
Wie konnte sie diesen peinlichen Fauxpas nur wieder ausbügeln? Grace überlegte fieberhaft, aber es war wohl eindeutig zu spät. Andererseits: Aus dieser Entfernung konnte man ganz bestimmt nicht besonders viel erkennen … hoffentlich.
Sie schlüpfte in ein Shirt mit Spaghettiträgern, Shorts und ein Paar Slipper und ging nach unten ins Erdgeschoss. In einer Stunde würde sie bei ihrer Mutter und bei Madeline anrufen. Aber zuerst wollte sie sich um den Garten kümmern.
Kennedy Archer fluchte, als er den Kaffee auf seiner Hose verschüttete. Schuld daran war die halb nackte Frau im Fenster. Evonnes Haus war noch nicht verkauft worden, und er hatte nicht damit gerechnet, jemanden am Fenster zu sehen. Schon gar nicht diese dunkelhaarige Schönheit, die ihm einen verschreckten Blick zugeworfen hatte. Und schon gar nicht so früh am Morgen. So, wie sie plötzlich zurückgeschnellt war, hatte sie offenbar nicht die Absicht gehabt, sich in ihrer ganzen Pracht zu zeigen. Ihr schöner Körper hatte sich dennoch bereits in sein Gedächtnis eingebrannt. Das würde wohl jedem so gehen. Seit dem Tod seiner Ehefrau vor zwei Jahren lebte Kennedy alleine.
“Daddy? Ist alles in Ordnung?”
Kennedy drückte das Handy fester gegen sein Ohr. Im selben Moment, in dem sein Sohn angerufen hatte, war ihm die Bewegung am Fenster aufgefallen – und er hatte laut aufgeschrien, als der heiße Kaffee sich über seinen Schoß ergoss.
“Alles klar, Teddy”, sagte er und versuchte verzweifelt, den nassen heißen Stoff seiner Hose nach oben zu ziehen, damit seine besonders empfindlichen Körperteile keinen Schaden nahmen. “Was gibt’s denn?”
Sein Sohn senkte die Stimme. “Ich will heute nicht bei Oma bleiben.”
Kennedy hatte sich das schon gedacht. Heath, sein zehn Jahre alter Sohn, kam sehr gut mit seiner Großmutter Camille aus. Er beklagte sich selten. Aber er war auch ein sehr ruhiger, geduldiger und bedächtiger Mensch – fast schon ein Intellektueller. Camille nannte ihn immer ihren “guten Jungen”.
Teddy war eine ganz andere Persönlichkeit. Er war quicklebendig und hatte mit acht Jahren schon seinen eigenen Kopf. Jeden Tag versuchte er aufs Neue, seine Großmutter herauszufordern, jedenfalls glaubte Camille, dass es ihm darum ging. Sie waren ständig dabei, ihre Kräfte zu messen. Kennedy jedoch wusste sehr wohl, dass Teddy kein Problemkind war. Man musste ihn einfach zu nehmen wissen. Raelynn hatte bis zu ihrem Tod einen sehr guten Draht zu ihrem Jüngsten gehabt.
“Wo willst du denn sonst hin?”, fragte Kennedy.
“Nach Hause.”
“Du kannst nicht nach Hause. Da ist niemand, der auf dich aufpasst.”
“Und was ist mit Lindy?”
Lindy war ein sechzehnjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft oder was man in dieser Gegend Nachbarschaft nannte. Ihr Grundstück grenzte an das der Archers, aber das Haus war ein ganzes Stück weit entfernt. Lindy war sehr nett, aber das letzte Mal, als sie zum Babysitten gekommen war, hatte sie ihren Freund mitgebracht, und sie hatten sich zusammen mit den Jungs Horrorfilme angesehen.
“Lindy kommt nicht infrage. Aber du könntest zu Mrs. Weaver gehen.”
“Nein, da will ich nicht hin!”
Alles wäre einfacher, wenn Raelynns Eltern nicht vor zehn Jahren nach Florida gezogen wären. Mit der Mutter seiner verstorbenen Ehefrau kam Teddy viel besser zurecht. Aber inzwischen sah er seine Großeltern mütterlicherseits nur noch ein- oder zweimal im Jahr. “Teddy, wir haben doch schon darüber gesprochen. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, ist es bei Oma Camille immer noch am besten. Sie reißt dir ja nicht den Kopf ab. Und letzte Woche ist sie mit euch sogar nach Jackson in den Zoo gefahren.”
“Ja, das war ja auch toll”, gab der Junge zu. “Aber … ich langweile mich hier. Kannst du nicht kommen und mich abholen?”
“Tut mir leid, Junge, aber ich muss heute arbeiten. Das weißt du doch.”
“Dann nimm mich doch einfach mit. Ich kann doch bei dir im Büro spielen.”
Kennedy hielt am Straßenrand an. Die Straße war kaum befahren um diese Zeit, aber er musste sich ein paar Taschentücher aus dem Handschuhfach holen und außerdem den Kaffee irgendwo hinstellen, wo er nicht wieder umfallen konnte. “Das geht nicht, jedenfalls nicht heute. Ich treffe mich mit meinem Wahlkampfleiter und einigen wichtigen Sponsoren zum Frühstück. Danach muss ich im Rotary Club eine Rede halten. Und später habe ich einen Termin mit einigen Wirtschaftsleuten.”
“Warum willst du unbedingt Bürgermeister werden?”
Das war bestimmt nicht der richtige Augenblick, um seinem Sohn mitzuteilen, wie es um seinen Großvater stand, obwohl es ihm am Telefon leichter fallen würde, das Thema anzusprechen, als unter vier Augen. Aber er konnte Teddy jetzt keine medizinischen Details erläutern und ihn dann damit alleine lassen. Nicht, nachdem er seine Mutter verloren hatte.
“Du weißt doch, dass Opa sich zur Ruhe setzen will, und dann ist dieser Posten zum ersten Mal seit dreißig Jahren unbesetzt. Seit ich klein war, habe ich mich darauf vorbereitet, eines Tages in seine Fußstapfen zu treten.”
“Und wann ist der Wahlkampf endlich vorbei?”
“Im November. Dann wird alles wieder einfacher, ob ich nun gewinne oder verliere.”
Teddy stöhnte laut auf. “Im November? Aber da bin ich ja schon wieder in der Schule.”
“Es ist ein anstrengendes Jahr, ich weiß.” Aber ganz bestimmt nicht schwieriger als das Jahr davor.
Kennedy zwang sich, nicht an die schwierigen ersten Monate ohne Raelynn zu denken. Er ging seinen Terminplan durch und entschied, dass er das Treffen mit Buzz und den anderen in der Pizzeria am Nachmittag absagen konnte. Er traf sich gern mit seinen alten Freunden; immerhin kannten sie sich schon seit der Schulzeit. Aber Teddy war jetzt wichtiger. “Wie wär’s, wenn ich dich und Heath um vier Uhr abhole und auf ein Eis einlade?” Dann konnte er immer noch kurz in der Pizzeria anhalten und Hallo sagen.
“Können wir nicht um sechs da hingehen?”
Kennedy, der die ganze Zeit versuchte, seine Hose trocken zu tupfen, hielt inne: “Um sechs? Aber um diese Zeit hole ich euch doch sowieso immer ab.”
“Ja, aber Oma will um vier mit uns schwimmen gehen.”
“Also hast du heute doch schon was vor.”
“Aber erst um vier.” Es gab eine kleine Pause, dann fragte der Junge: “Fahren wir am Wochenende zelten?”
“Vielleicht.”
“Sag doch einfach ja. Bitte!”
“Wenn du es schaffst, dich heute nicht mit Oma zu streiten.”
Teddy stieß einen lauten Seufzer aus. “Okay.”
“Was macht Heath denn gerade?”
“Der sieht fern, bis wir schwimmen gehen. Oma hat immer Angst, dass wir ihren Teppich schmutzig machen.”
“Ich dachte, du mähst bei den Nachbarn den Rasen?”
“Oje. Oma kommt”, flüsterte der Junge und legte auf.
Kennedy wusste, dass Camille Teddys Bitte als persönliche Beleidigung auffassen würde. Sie bemühte sich, ihren Enkeln gerecht zu werden. Es war nicht einfach für sie, sich fünf Tage in der Woche um zwei Jungs zu kümmern, nachdem sie so lange nichts mit Kindern zu tun gehabt hatte. Dennoch war diese Ablenkung für sie wichtig. Die Krebserkrankung ihres Mannes machte ihr schwer zu schaffen. Und deshalb versuchte sie immer wieder, Kennedy davon zu überzeugen, dass sie und die Jungs prächtig miteinander auskamen.
Oje. Oma kommt …
Offenbar lernte Teddy langsam, wie es ihm möglich war, Konfrontationen mit seiner Großmutter zu vermeiden.
Kennedy lachte vor sich hin, als er das Handy in die Halterung am Armaturenbrett schob. Sein Jüngster war ein schwieriges Kind, das stimmte; er war ungestüm und kaum zu bändigen. Wäre Camille jünger gewesen und nicht so angespannt, hätte sie das bestimmt leichter akzeptiert.
Irgendwie wird er den Tag schon überstehen, dachte er. Wahrscheinlich ging Teddy die strenge Art seiner Großmutter gegen den Strich. Dass sie ihre Enkel von ganzem Herzen liebte, das stellte allerdings niemand, nicht einmal Teddy, infrage.
Kennedy sah auf die Uhr. Es wurde Zeit, er hatte eine Menge zu tun. Und dank der Frau, die plötzlich am Fenster erschienen war, musste er noch mal nach Hause fahren und sich umziehen.
“Hattest du etwa vor, mir zu verheimlichen, dass du in der Stadt bist?”
Grace kniete im Garten und drehte sich erschrocken um. Ihre Mutter kam einmal pro Jahr nach Jackson, um sie zu besuchen, und dies war das erste Mal seit Grace’ Schulzeit, dass sie in Stillwater zusammentrafen.
Grace räusperte sich und stand auf. Sie hatte eigentlich nur ein paar Stunden lang im Garten arbeiten wollen, aber nun war der ganze Vormittag schon vorbei. Irgendwie hatte sie es als wichtige Mission aufgefasst, Evonnes Garten wieder zu seiner alten Schönheit zu verhelfen. Obwohl sie völlig verschwitzt war und wusste, dass sie morgen einen furchtbaren Muskelkater haben würde, hatte sie mit großem Eifer umgegraben und Unkraut gejätet.
Da sie schmutzige Handschuhe trug, musste sie sich den Schweiß mit dem Unterarm aus dem Gesicht wischen. “Tut mir leid, Mom”, sagte sie und lächelte verlegen. “Ich hatte es mir fest vorgenommen, aber dann hatte ich einfach so viel zu tun … hier.”
Irene deutete auf die Pflanzen. “Dieses Kraut war dir wichtiger?”
Offensichtlich war ihre Mutter zutiefst verletzt. Grace atmete tief ein und ging über den Rasen auf sie zu, um sie zu umarmen. Obwohl sie diesen Augenblick gefürchtet hatte, war sie glücklich, ihre Mutter zu sehen. Sie bewunderte sie, hatte sie oftmals vermisst, und doch rief ihre Gegenwart viele widerstreitende Gefühle in ihr wach. “Ich kann das einfach nicht so verwildert lassen, es stört mich”, sagte sie. “Und ich bin mir sicher, dass es Evonne auch gestört hätte. Und außerdem …” Sie trat einen Schritt zurück, zog ihre Mütze ab und warf einen Blick in den grauen Himmel. “… wollte ich gern fertig sein, bevor es anfängt zu regnen.”
Irene schien das für keine besonders gute Entschuldigung zu halten, aber wie Grace sie kannte, würde sie das Thema jetzt wahrscheinlich fallen lassen. Über die Jahre hatten sie ein Schema entwickelt, wie sie mit den Spannungen umgingen, die zwischen ihnen herrschten. Sie hatten sich stillschweigend darauf verständigt, dass es besser war, bestimmte Konfliktthemen nicht anzusprechen.
“Gut siehst du aus”, sagte Grace und meinte es auch so.
“Ich bin zu dick”, antwortete ihre Mutter, aber mehr als fünf oder sechs Kilo hätte sie gar nicht entbehren können. Sie war eben sehr eitel, das sah man schon daran, wie sie sich selbst für unwichtige Ereignisse perfekt kleidete und zurechtmachte.
“Ach was”, sagte Grace. “Du bist genau richtig.”
Ihr Lächeln entspannte sich, als sie merkte, dass ihre Mutter sich über das Kompliment freute. Sie war etwas kleiner als ihre Tochter, hatte aber die gleiche ovale Gesichtsform und ebenso blaue Augen. Grace trug ihre schwarzen Haare gern zu einem Knoten gebunden und benutzte kaum Make-up. Irene hingegen schminkte sich gern auffällig und ließ ihr Haar offen.
“Molly glaubt, du hast einen Freund”, sagte Grace. Sie war neugierig, ob ihre Schwester recht gehabt hatte.
Ihre Mutter machte eine abwehrende Handbewegung. “Ach was. Aber sie trifft sich immer noch mit diesem Mann, den sie Weihnachten mitgebracht hatte.”
“Bo ist nur ein guter Freund, das weißt du doch. Aber ich glaube langsam, dass du mir etwas verheimlichen willst, so eifrig, wie du das Thema gewechselt hast.”
“Mit wem sollte ich mich denn treffen? Hier kann mich doch sowieso niemand leiden.”
Ob das immer noch stimmte, war die Frage. Früher war es tatsächlich so. Als Irene Montgomery Reverend Barker geheiratet hatte und mit ihren drei Kindern aus dem benachbarten Booneville zu ihm gezogen war, war Grace erst neun Jahre alt. Aber auch schon mit neun bekommt man mit, was die Nachbarn tuscheln.
Guckt sie euch an, wie sie hochnäsig durch die Gegend läuft! Als hätten wir in Stillwater nicht genug aufrechte Frauen, die viel besser zu unserem Reverend passen würden. Sie ist doch mindestens fünfzehn Jahre jünger als er! Bestimmt will sie nur an sein Geld ran …
Lee Barker lebte durchaus in bescheidenen Verhältnissen und besaß nichts weiter als sein Einkommen als Seelsorger und die Farm. Aber es war mehr, als Irene und ihre Kinder je besessen hatten, und das genügte, um die Leute in Stillwater misstrauisch werden zu lassen. Alle waren der Ansicht, Grace’ Mutter hätte sich etwas genommen, was ihr nicht zustand.
Dass Reverend Barker bei jeder Gelegenheit zwar undeutliche, aber dennoch abschätzige Bemerkungen über seine Frau fallen ließ, war nicht besonders hilfreich. Sogar in seinen Predigten machte er nicht Halt davor. Irenes Begeisterung für ihren neuen Ehemann verflog sehr schnell, je besser sie ihn kennenlernte.
Grace war es immer ein Rätsel, warum die Menschen in Stillwater ihm so kritiklos ergeben waren – und wie es diesem schlechten Menschen gelungen war, alle davon zu überzeugen, ein Heiliger zu sein.
Eine schwielige Hand packt sie am Arm. “Sei ganz still”, raunt eine tiefe Stimme in ihr Ohr. Als sie zu wimmern beginnt, wird der Griff des Mannes, den sie Daddy nennen soll, fester. Er will sie zum Gehorsam zwingen. Seine leibliche Tochter Madeline schläft im Bett gegenüber. Grace weiß, dass sie eine schlimme Strafe erwartet, wenn sie ihre Stiefschwester aufweckt.
“Grace, ist alles in Ordnung?”, fragte ihre Mutter.
Die Erinnerung verblasste. Grace verschränkte die Arme und bemühte sich, gelassen zu bleiben. Aber es gelang ihr nur ein gequältes Lächeln: “Alles bestens.”
“Wirklich?”
“Bestimmt”, versicherte sie. Aber sie spürte, wie das Gefühl von Zuversicht und Zufriedenheit, das sie eben noch erfüllt hatte, verschwand. Sie fühlte sich, als wäre sie aus der warmen Sonne in einen kalten Keller hinabgestiegen. Die Bilder und Gefühle, die sie tief in ihr Unterbewusstsein verbannt hatte, erwachten wieder zum Leben. “Es … es ist einfach zu heiß hier draußen. Wollen wir uns nicht lieber auf die Veranda setzen?”, schlug sie vor und wandte sich dem Haus zu.
“Nach dreizehn Jahren … Ich kann wirklich nicht glauben, dass du zurückgekommen bist”, sagte ihre Mutter und folgte ihr.
Bevor sie richtig darüber nachgedacht hatte, erwiderte Grace spontan: “Ich kann nicht glauben, dass du hiergeblieben bist.”
“Ich konnte nicht weg”, sagte Irene beleidigt. “Glaubst du etwa, ich würde Clay einfach verlassen?”
“So wie ich es getan habe?”
Ihre Mutter schaute sie erschrocken an. “So habe ich das nicht gemeint.”
Grace presste die Hand gegen die Stirn, nachdem sie auf der Hollywoodschaukel Platz genommen hatte. Keiner von denen, die die Wahrheit kannten, hatte ihr je Vorwürfe gemacht. Sie bemitleideten sie, wussten aber nicht, wie sie sonst damit umgehen sollten. Niemand machte sie verantwortlich, das tat nur sie allein. “Entschuldige”, sagte sie. “Es fällt mir nicht leicht, hier zu sein.”
Ihre Mutter setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. Sie sagte nichts, hielt sie aber eine Weile fest, während sie vor und zurück schaukelten.
Die Spannung zwischen ihnen schwächte sich ab. Grace wünschte, ihre Mutter wäre vor achtzehn Jahren so auf sie zugegangen.
“Evonnes Haus ist wirklich schön, nicht wahr?”, sagte Irene nach einer Weile.
“Ja. Ich mag es sehr gern.”
“Hast du vor, länger zu bleiben?”
“Drei Monate vielleicht.”
“Drei Monate! Das ist ja toll!” Irene ließ die Hand ihrer Tochter los und stand auf. “Du weißt doch, dass ich dich liebe, Grace. Vielleicht habe ich es nicht oft genug gesagt, vielleicht habe ich mich nicht richtig um dich gekümmert, aber du sollst wissen, dass ich dich immer geliebt habe.”
Grace wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Und so stellte sie die Frage, die sie schon viel früher hatte aussprechen wollen. “Glaubst du, etwas Schlimmes ist aus der Welt, weil man die Augen davor verschließt?”
Irene sah sie eine ganze Weile an. Die Frage hatte sie tief getroffen. “Wem nützt es, wenn man ständig darauf herumreitet? Ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen.” Sie ging zum anderen Ende der Veranda, und ihre Absätze klapperten über die Holzbohlen, bis das Geräusch ihrer Schritte vom Rasen abgedämpft wurde. “Ich hab noch eine Verabredung. Ruf mich doch später an, falls … falls du es möchtest.”
“Das tue ich bestimmt”, versicherte Grace und sah ihrer Mutter nach, wie sie durch den Vorgarten zur Straße stolzierte.
In der Pizzeria war es angenehm kühl. Grace hatte geduscht, bevor sie losgegangen war, fühlte sich aber schon wieder verschwitzt. Jetzt am Nachmittag war die Hitze beinahe unerträglich. Es war schwül und stickig, aber der Regen ließ noch immer auf sich warten. Wahrscheinlich würde es erst heute Abend anfangen zu tröpfeln.
“Bitte sehr, Ihre Pizza.”
Die jugendliche Kellnerin stellte schwungvoll einen Teller vor sie hin. Grace schob ihren Salatteller ein Stück zur Seite und schaute zur Tür, wo gerade eine Gruppe Männer eintrat.
Sie bedankte sich bei der Kellnerin und vermied es, sie zu lange anzusehen. Sie wollte jetzt nicht in irgendein Gespräch verwickelt werden. Sie war nur hergekommen, um eine Kleinigkeit zu essen und sich ein wenig von der Hitze zu erholen.
Aber ein paar Minuten später hörte sie, wie die Männer über sie sprachen.
“Doch, Tim, das ist sie ganz bestimmt.”
“Die willige Gracie? Glaub ich nicht.”
“Aber ja! Rex Peters hat mir erzählt, dass sie zurückgekommen ist.”
“Warum denn?”, fragte ein anderer. “Ich dachte, sie ist jetzt Staatsanwältin irgendwo. Es stand in der Zeitung.”
Grace konnte die Antwort nicht verstehen. Sie nahm sich vor, die Männer zu ignorieren und sich auf ihr Essen zu konzentrieren. Aber wenig später stieß einer einen leisen Pfiff aus und machte eine Bemerkung darüber, wie gut sie aussah. Sie konnte einfach nicht anders. Sie musste einen Blick hinüberwerfen.
Einer der Männer stand mit dem Rücken zu ihr am Tresen und gab seine Bestellung auf. Die anderen vier kannte sie von früher. Auf der Highschool waren sie gute Sportler, und Grace hatte sie bewundert. Aber diese Begegnung war ihr schrecklich peinlich, und sie wäre am liebsten davongerannt. Die alten Zeiten waren längst vorbei. Sie hatte sich verändert.
“Vielleicht würden wir sie ja besser erkennen, wenn sie keine Klamotten anhätte”, sagte Joe Vincelli und kicherte dabei auf seine typische Art, an die Grace sich jetzt wieder erinnerte. Lee Barkers Neffe. Der Reverend hatte ihn immer bevorzugt behandelt. Auch an ihren wenig schmeichelhaften Spitznamen erinnerte sie sich wieder. Irgendeiner hatte ihn auf die Tür ihres Spinds geschrieben.
“Sei doch still, sie hört uns doch”, sagte ein anderer. War das Buzz Harte? Sie war sich nicht sicher. Er hatte sich am meisten verändert, jedenfalls war von seiner einstigen Haarpracht nicht mehr viel übrig.
Sie lästerten weiter, lachten laut, und Grace wurde die Situation immer peinlicher. Ihr Herz begann heftig zu pochen. Sie starrte verlegen auf ihren Teller. Vor vierzehn oder fünfzehn Jahren hatte sie Sex mit drei dieser Männer gehabt, mal auf dem Rücksitz eines Autos, mal in einem Hauseingang. Anscheinend hatten diese Männer angenehmere Erinnerungen daran als sie. Sie konnte nicht mehr verstehen, dass sie diese Kerle überhaupt an sich rangelassen hatte, vor allem die, die auf die gleiche Schule gingen.
Aber damals hatte sie nach etwas gesucht, was sie nirgendwo finden konnte …
Sie fühlte sich schwach und verletzlich und fragte sich, wie sie aus diesem Lokal herauskommen könnte, ohne dicht an ihnen vorbeigehen zu müssen.
Und dann hörte sie wieder Joes Stimme, und er sprach immer lauter, genau wie früher, als er der Stimmgewaltigste von allen gewesen war. “Die konnte man ganz schön schnell rumkriegen. Musstest nur mit dem Finger schnippen, und schon machte sie die Beine breit. Ich hab’s ihr mal im Stadion unter der Tribüne besorgt. Meine Eltern saßen nichts ahnend nur ein paar Meter entfernt.”
Grace’ Brust zog sich zusammen, als sie alle zusammen loslachten. Sie bekam kaum noch Luft. Damals hatte sie sich danach gesehnt, von Joe gemocht und anerkannt zu werden. Und außerdem wollte sie ihm etwas zurückgeben. Sie hatte ihm den Onkel genommen.
“Mich hat sie mal gefragt, ob sie ein paar Wochen meine Freundin sein darf”, sagte Tim. Er sprach viel leiser als Joe, aber sie konnte sich ungefähr zusammenreimen, was er erzählte. “Ich hab natürlich Ja gesagt. Dann hab ich sie gebumst und sie anschließend davongejagt.” Dann lachte er ungläubig. “Wie so jemand Dummes einen Studienplatz in Georgetown ergattern konnte, ist mir schleierhaft.”
Irgendeiner hatte ihm offenbar einen Schlag versetzt, vielleicht Buzz, jedenfalls schrie er auf.
“Dumm? Komm schon! Sie ist definitiv nicht dumm …” Er senkte die Stimme. “… irgendwie gestört. Bei denen Zuhause muss irgendwas Eigenartiges passiert sein.”
“Nichts war eigenartig”, protestierte Joe, “bis sie meinen Onkel umgebracht haben.”
“Du weißt doch gar nicht, was mit deinem Onkel passiert ist”, sagte Tim. Joe widersprach, aber Tim hob die Hand: “Glaub mir, da war von Anfang an etwas Merkwürdiges im Gang.”
“Wegen diesem Besen von Mutter”, brummte Joe.
Dann wurde geflüstert, aber Grace hörte nicht mehr hin. Sie war vollauf damit beschäftigt, Haltung zu bewahren.
Leider machte ihr Magen nicht mit. Ihr wurde immer übler, als sie sich vergegenwärtigte, was sie damals mit diesen drei Männern gemacht hatte.
Sie hätte es gern ungeschehen gemacht. Aber das war leider nicht möglich. So etwas hing einem für immer nach.
“Geh doch hin und sag Hallo zu ihr, Joe”, meinte Tim. “Vielleicht kannst du’s ihr gleich hier besorgen. Und wenn du’s gut machst, erzählt sie dir vielleicht, was mit deinem Onkel passiert ist.”
Joe knurrte, und jetzt kam der Mann, der die Bestellung aufgegeben hatte, wieder an den Tisch zurück und fragte mit lauter, klarer Stimme: “Wovon redet ihr denn eigentlich?”
Grace hatte sein Gesicht noch gar nicht gesehen, aber das war auch nicht nötig. Sie wusste, dass das Kennedy Archer war, damals der attraktivste, sportlichste und begehrenswerteste Junge von allen. Sie konnte nicht widerstehen. Sie sah zu ihm hinüber.
Er war nicht dicker geworden. Er hatte auch keine Glatze wie einige seiner Freunde. Immer noch groß und breitschultrig, hatte er immer noch dunkelblonde Haare und Grübchen, wenn er lächelte. Auf zahllosen Plakaten in der Stadt war sein Gesicht zu sehen. Er kandidierte für das Amt des Bürgermeisters.
Ihre Blicke trafen sich. Sie sah, wie überrascht er war, als er sie erkannte. Er hörte auf, an seinem Schlips zu ziehen, dessen Knoten er gerade lockern wollte.
Grace schaute sofort woanders hin. Normalerweise war um diese Zeit am Nachmittag in keinem Restaurant etwas los. Aber ausgerechnet jetzt musste sie auf Kennedy Archer und seine Freunde treffen. Was machten sie eigentlich um diese Zeit in einer Pizzeria? Aus dem Alter, in dem man sich an solchen Orten herumtrieb, waren sie doch längst raus.
Sie erinnerte sich noch daran, wie sie mit sechzehn als Aushilfskellnerin hinter dem Tresen gestanden und sie beobachtet hatte. Als Jungs hatten sie ständig angegeben und versucht, cool zu sein. Grace fiel es schwer, ihre widerstreitenden Gefühle zu beherrschen. Sie hätte niemals erwartet, in diesem Lokal mit diesen Männern konfrontiert zu werden, und auch nicht, dass ein Zusammentreffen mit ihnen sie derart erschüttern würde. Mit einem Mal war sie wieder die kleine Grace von damals, die verzweifelt nach Zuneigung suchte.
Wie hatte sie nur so kurzsichtig sein können? Sie hätte dieses Restaurant niemals betreten dürfen.
Sie hatte sich allzu sehr mit ihren Problemen als erwachsener Mensch befasst, sich gefragt, wie sie Clay und Irene begegnen sollte oder ihrer Stiefschwester Madeline, die sie noch immer nicht angerufen hatte. An ihre Schulzeit hatte sie kaum noch gedacht. Es war jene düstere Zeit, in der sie sich mehr als jeder andere verachtet hatte.
Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sie nicht länger hier sitzen bleiben konnte. Sie spürte, wie ihr Magen rebellierte.
Sie erhob sich so würdevoll wie möglich und ging zügig zu den Toiletten.
Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, erleichtert darüber, die verwunderten Blicke hinter sich gelassen zu haben, da taumelte sie auch schon in eine der Zellen, ging in die Knie und musste sich übergeben.
3. KAPITEL
Grace kam nicht zurück, und die Männer wandten sich anderen Themen zu: Der kommenden Wahl, den Baumwollpreisen und dass sie im August gemeinsam mit ihren Söhnen zum Angeln fahren wollten. Kennedy ertappte sich dabei, wie er immer wieder zu dem Tisch hinüberschielte, an dem Grace Montgomery gesessen hatte. Ihr Essen stand dort immer noch. Sie hatte ein bisschen Salat gegessen, die Pizza aber nicht angerührt, und die wurde nun von Minute zu Minute kälter.
War alles in Ordnung mit ihr? Er lehnte sich zurück und schaute Richtung Toiletten, aber sie war nirgends zu sehen. Wie lange wollte sie denn noch dort bleiben?
“He, Kennedy, was ist denn los mit dir?”, fragte Joe und stieß ihn in die Seite. “Glaubst du, du bist jetzt was Besseres als wir, seit du Bürgermeisterkandidat bist?”
“Ich war immer was Besseres als ihr Schwachköpfe”, sagte er lachend, aber nach einigen halbherzigen Bemerkungen übers Angeln schweiften seine Gedanken wieder ab. Warum kam Grace nicht mehr zurück? Die Männer hatten ihr hinterhergerufen und gepfiffen, als sie zur Toilette gegangen war, und dumme Bemerkungen gemacht, die nur bewiesen, dass sie mehr Testosteron im Blut als Hirn im Kopf hatten. Er hätte ihr gern etwas gesagt, um das alles abzuschwächen und ihr zu helfen. Er hätte ihr gern geholfen, sich in ihrer alten Heimat wieder mehr wie zu Hause zu fühlen. Falls das möglich war.
Weitere zehn Minuten verstrichen.
Ihre eigenen Pizzas wurden serviert. Aber auch nachdem sie sie verspeist hatten, war Grace noch nicht zurück.
Kennedy warf wieder einen Blick Richtung Toiletten. Nichts.
“Du bist ja so abwesend. Was ist denn los?”, fragte Buzz.
“Bin ich doch gar nicht”, widersprach Kennedy, während er an die halb nackte Frau dachte, die er am Morgen im Fenster gesehen hatte. Jetzt wusste er, wer es gewesen war. Grace. Offenbar wohnte sie im Haus von Evonne. Zwei so gut aussehende Frauen konnten gar nicht neu sein in Stillwater.
Aber warum mietete sie sich ein eigenes Haus, wenn doch ihre Mutter und ihr Bruder hier lebten? Die Montgomerys hatten Platz. Was stimmte nur nicht mit dieser Familie?
Sie tranken jeder noch ein Bier, aber Grace blieb verschwunden. Er wandte sich an Buzz: “Wo ist sie denn hin?”
“Wer?”, fragte Tim zurück, der zugehört hatte.
“Ach, vergiss es”, brummte Kennedy.
“Sie will uns wohl ihre Pizza überlassen”, stellte Ronnie fest. “Soll ich ein Stück stibitzen? Wäre das nicht witzig, wenn sie zurückkäme und die Hälfte ihrer Pizza wäre weg?”
“Na los, mach doch”, drängte Joe.
Ronnie schob den Stuhl geräuschvoll zurück und stand auf, aber Kennedy hielt ihn am Arm fest.
“Ach komm schon, Kennedy. Es ist doch nur ein Scherz.”
“Vergiss es. Ihr wisst doch, dass sie eine schwere Kindheit hatte. Lasst sie in Ruhe, okay?”
Joe warf ihm einen erstaunten Blick zu. “Wusste ja gar nicht, dass du was für die willige Gracie übrig hast. Soweit ich mich erinnere, hättest du sie früher nicht mal mit der Kneifzange angefasst.” Er krauste demonstrativ die Nase. “Du warst ja ein Archer.”
“Ich war mit Raelynn zusammen”, sagte Kennedy.
“Ja, eben, er hatte eine Freundin”, fügte Buzz hinzu.
“Ich doch auch”, meinte Joe und lachte vor sich hin. “Aber das hatte ja nichts mit der willigen Gracie zu tun. Ich mochte sie ja nicht mal.”
Kennedy kannte diese Männer seit der Grundschule, aber manchmal gingen sie ihm ganz schön auf die Nerven. Vor allem Joe, der in solchen Situationen aus allen Anwesenden nur das Allerschlimmste hervorkitzelte. Wenn Joe ihm damals, als er zwölf Jahre alt gewesen war, nicht das Leben gerettet hätte, wären sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr befreundet. “Hört auf, ich will nichts mehr davon hören.”
Die anderen starrten ihn an. Irgendjemand murmelte was von dem Stress, den er wahrscheinlich zurzeit hatte, und nach einer Weile ließ die Spannung nach. Schließlich sprachen sie über unverfänglichere Themen wie Automarken und die kommende Footballsaison.
Kennedy hörte zu, bis er es nicht mehr aushielt. Was war denn nur mit Grace los? Er murmelte einen Fluch vor sich hin und stand auf, um zur Damentoilette zu gehen. Er klopfte an die Tür und rief: “Grace? Ist alles in Ordnung?”
Keine Antwort. Drinnen hörte man nur den Ventilator summen.
“Grace? Wenn du nicht antwortest, muss ich reinkommen.”
Immer noch nichts.
Er schob die Tür auf – und sah, wie sie sich mühsam aufrichtete. Aber dann warf sie sich gegen die Tür und drückte sie mit aller Kraft wieder zu.
“Mir … mir geht’s gut”, sagte sie. Nur klang es so, als würde sie kaum noch Luft bekommen.
So blass, wie ihr Spiegelbild ausgesehen hatte, konnte es ihr gar nicht gut gehen. Sie war krank, das war ganz offensichtlich.
“Soll ich dich nach Hause bringen?”, fragte er.
Wieder antwortete sie nicht. Sie lehnte sich noch immer gegen die Tür, und er wollte sie nicht mit Gewalt aufstoßen.
“Ich kann dich nach Hause bringen, wenn du möchtest.”
“Nein, geh … geh lieber zu deinen Freunden zurück. Die sind doch so witzig. Du willst doch bestimmt nichts verpassen.”