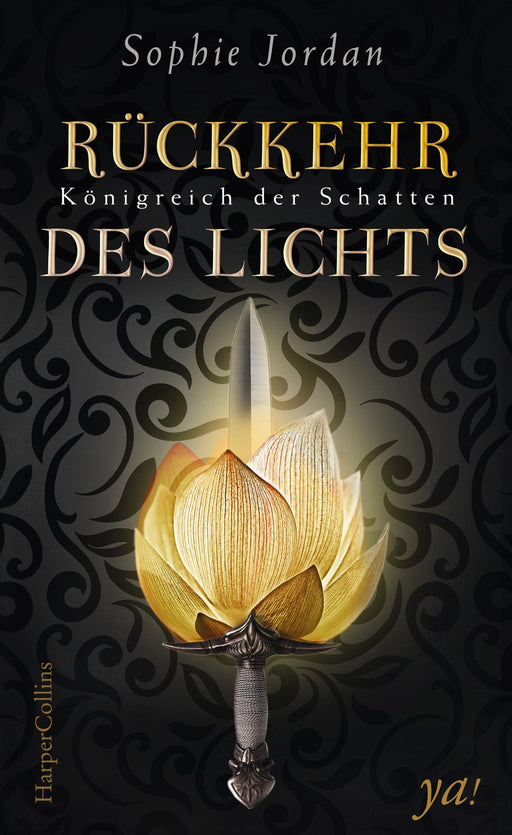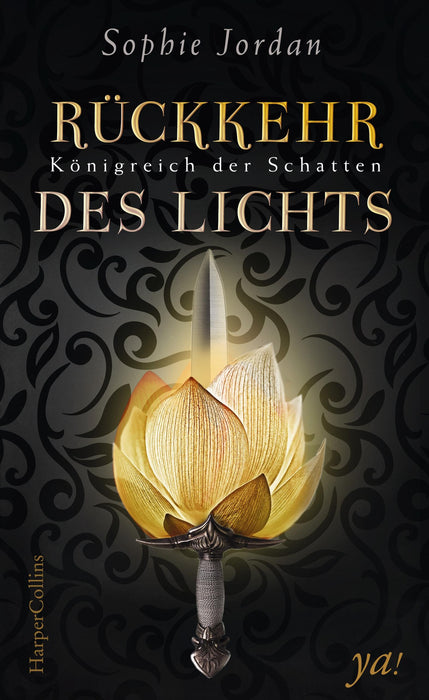
Königreich der Schatten - Rückkehr des Lichts
Seit Jahren herrscht Finsternis über dem Königreich Relhok. Doch Luna, die wahre Königin des Reiches, ist es mithilfe des Waldläufers Fowler gelungen, aus Relhok zu fliehen. Der Mörder ihrer Eltern droht, auch sie zu töten. Auf der Flucht wird ihr Verbündeter lebensgefährlich verletzt. Nur die fremden Soldaten des Königs Lagonia können ihnen helfen. Doch kann sie ihnen vertrauen? Um endlich der Dunkelheit zu entkommen und ihre Feinde zu besiegen, müssen sich Luna und Fowler ihrer Bestimmung stellen.
"Fesselnd geschrieben!"
lovelybooks.de
"Sophie Jordan hat einen unglaublich intensiven Schreibstil"
leser-welt.de
"Ich wurde wirklich von der ersten Seite an von Autorin Sophie Jordan mitgerissen." hisandherbooks.de
"Suchtpotenzial"
wonderworld-of-books-from-hannah.blogspot.de