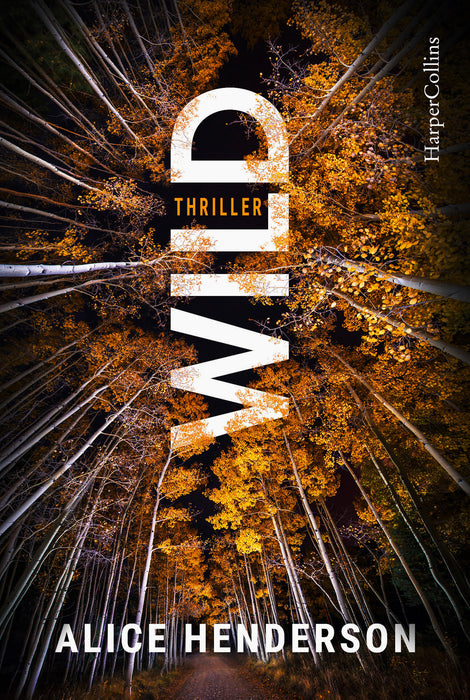
Wild
Allein zwischen den schroffen Gipfeln der Rocky Mountains. Doch die größte Gefahr geht nicht von der Natur aus …
Wildtierbiologin Alex Carter entgeht bei einer öffentlichen Ehrung nur knapp einem Amokläufer: Nur der gezielte Schuss eines Unbekannten rettet ihr das Leben. Verstört von den Ereignissen nimmt sie spontan ein Jobangebot an, das sie in die Wildnis Montanas führt. Dass ihr die Dorfbevölkerung am Fuße der Berge nicht allzu freundlich gesinnt ist, stört sie wenig, doch die Übergriffe auf sie werden immer dreister. Da filmen ihre Nachtsichtkameras einen Verletzten, der durch den Wald irrt – den sie aber nicht wiederfindet. Bald ist klar, dass die Bewohner dieser Wildnis ein grauenhaftes Geheimnis hüten. Aber als Alex das Ausmaß der Verbrechen begreift, ist es bereits zu spät …
»Ein eher ungewöhnlicher Thriller, der Trendthemen bedient und für eine breite Zielgruppe geeignet ist.« Deborah Schneider, EKZ-Bibliotheksservice, KW 18/2021
»„Wild“ ist in rasanter Krimi-Aktion verpackte Umweltaufklärung par excellence.« Manfred Hitzeroth, Oberhessische Presse, 02.10.2021


