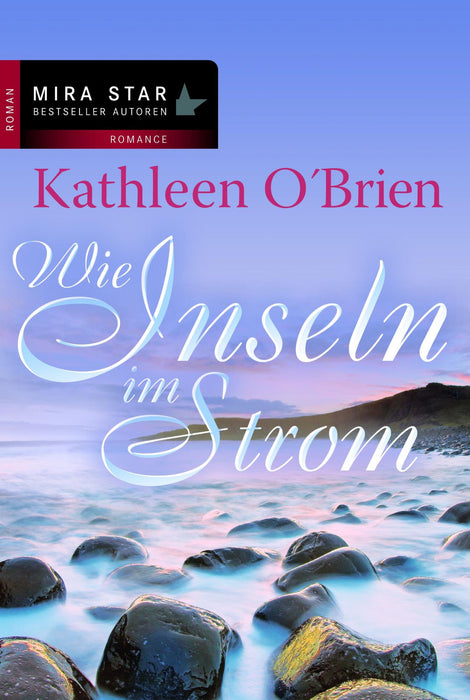
Wie Inseln im Strom
Lacy Morgan, elegant in blauer Seide, hat in den letzten Jahren viel Bildung erworben. Doch eins hatte sie darüber vergessen - wie man fühlt. Denn als Adam damals ging, nahm er ihre Liebe mit. Und so ist aus Lacy im Lauf der Zeit eine kühle Schönheit mit einem Herz aus Eis geworden. Adam Kendall erkennt sie kaum wieder, als er nach Pringle Island zurückkehrt. Vorsichtig versucht er, ihre seelischen Wunden zu heilen und den Panzer um ihr Herz zu durchbrechen.


