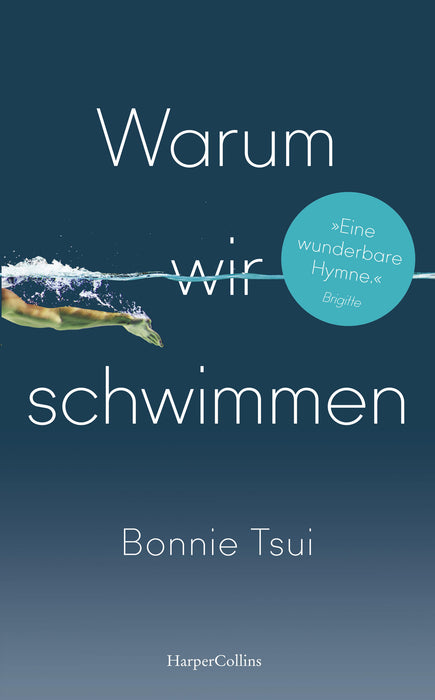
Warum wir schwimmen
»Ein Juwel von einem Buch, eine Hymne aufs Wasser und unseren Platz darin.«
James Nestor, Autor des SPIEGEL-Bestsellers »Breath. Atem«
Unsere Vorfahren schwammen, um zu überleben. Heute schwimmen wir in arktischen Gewässern und durchqueren breite Kanäle, weil wir die Herausforderung mögen. Schwimmen ist ein ruhiger und meditativer Sport in einer chaotischen Zeit. Schwimmen ist gesund, gemeinschaftsfördernd, existenziell. Jeder Mensch sollte es können.
Ob ein Schwimmclub im ehemaligen Palastbad Saddam Husseins in Bagdad, moderne Samurai-Schwimmer in Japan, verpflichtender Schwimmunterricht vollständig bekleidet in den Niederlanden, ein isländischer Fischer, dessen Physis einer Robbe gleicht, die ersten öffentlichen Schwimmbäder in Chicago und New York oder die Bajau-Seenomaden von Malaysia, deren Kinder es schon schaffen, bis zu 70 Meter in die Tiefe zu tauchen, ohne einmal Luft holen zu müssen.
Mit ihren kurzweiligen und wissenswerten Portraits über weltweite Schwimmkultur lässt uns die Literaturwissenschaftlerin und ehemalige Leistungsschwimmerin Bonnie Tsui tief abtauchen in die faszinierende Welt des Wassers, die uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional bereichert.
»Eine großartige Geschichte. Ich liebe dieses Buch.« Christopher McDougall, Autor des Bestsellers Born to Run
»Absolut wundervoll.« The New York Times
»Warum wir schwimmen? Das Buch gibt eine Fülle von Antworten.« Der Tagesspiegel
»Die US-amerikanische Autorin Bonnie Tsui erzählt in ihrem Buch ›Warum wir schwimmen‹ spannende Geschichten über diese uralte Fortbewegungsart.« Kristian Teetz, RND
»Eine Perle unter den Sachbüchern, nicht nur für Menschen, die das Wasser lieben.« Radio Bremen Zwei


