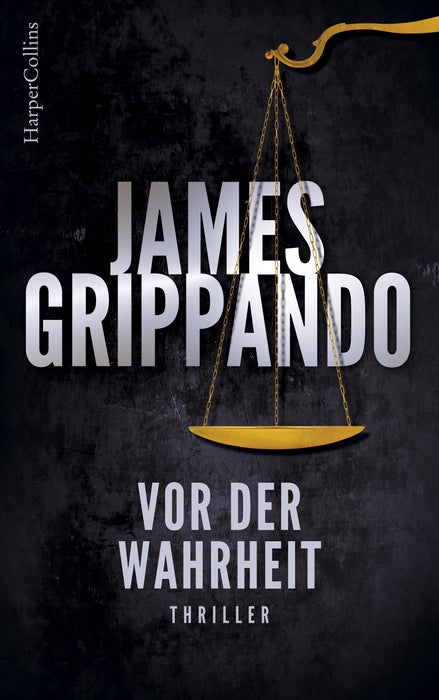
Vor der Wahrheit
Strafverteidiger Jack Swyteck ist in Florida bekannt als Experte für die schwierigsten Fälle aus dem Todestrakt. Auch Dylan Reeves ist einer von ihnen: eine Siebzehnjährige wird vermisst, und ihre letzten Spuren finden sich in Reeves’ Auto. Doch dann wird Swyteck von der Mutter der Vermissten kontaktiert, die behauptet, ihre Tochter habe sie angerufen. Jack bleiben nun dreißig Tage, um die Vollstreckung des Todesurteils zu verhindern …
"Grippando packt einen von der ersten Seite an."
Harlan Coben
"In einer Karriere mit vielen guten Büchern, zählt "Vor der Wahrheit" zu seinen besten."
Miami Herald
"Packend … "Vor der Wahrheit" führt einem vor Augen was für ein Schriftsteller Grippando ist. Und sichert ihm weiterhin einen Platz in der Spitzenklasse der Justizthriller-Autoren."
Huffington Post

