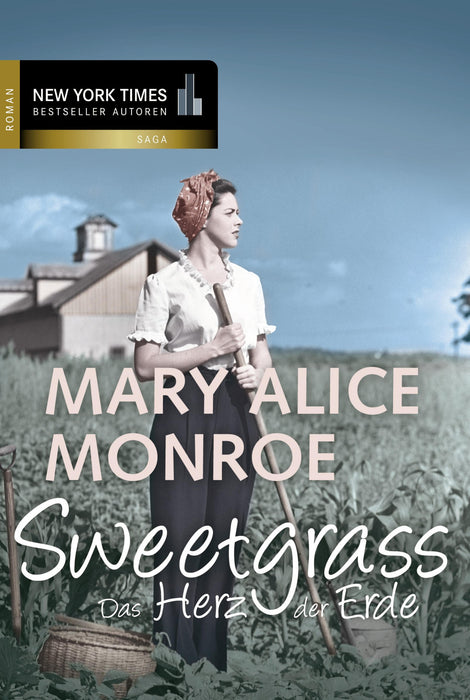Mary Alice Monroe
Sweetgrass
Das Herz der Erde
Roman
1. KAPITEL
“Bis vor nicht allzu langer Zeit hat sich an der Küstenregion mit ihren Inseln, Sümpfen, ruhigen Bächen und von Eichen gesäumten Straßen kaum etwas gewandelt – in letzter Zeit aber gehören Veränderungen zur Tagesordnung, oft grundlegend und nicht immer zum Besseren.”
(National Trust for Historic Preservation)
Im März kann das Wetter im Lowcountry von South Carolina ausgesprochen launisch sein. An einem Tag ist es mild, die Luft voller süßer Gerüche, und es zaubert ein vorsichtiges Lächeln auf die Gesichter der Hoffnungsvollen, die schon von kühlen kräftigen Drinks an schwülen Nachmittagen träumen, von cremeweißen Magnolienblüten und einer würzigen Brise, die vom Meer herüberweht. Und dann schlägt es plötzlich und über Nacht um. Auf einmal kommt Kaltluft heran, und der Winter streckt seine eisigen Fühler aus und legt einen Nebelschleier über die grauen Sümpfe.
Mama June Blakely hatte auf einen zeitigen Frühling gehofft, aber sie war erfahren genug, um immer ein Auge auf den Himmel zu haben, damit sie dunkle Wolken rechtzeitig ausmachte. Ein träger Dunst lag auf dem Wasser, so dick, dass Mama June Blakely’s Bluff kaum noch erkennen konnte, das wie eine finstere Klaue in den graugrünen Atlantik hineinragte. Ein trauriges Lächeln trat auf ihre Lippen, denn das Kliff war ihr schon immer wie ein passendes Sinnbild für die turbulente Geschichte ihrer Familie vorgekommen.
Ganz oben auf dem Kliff stand ein verwittertes Haus, das der Familie seit Generationen gehörte. Über unzählige Hurrikans und Stürme war Bluff House die Familienzuflucht geblieben, auch als der Großteil des Landbesitzes der alten Familien von Charleston lange verkauft war. Jedes Mal, wenn Mama June das Haus sah, überwältigten Erinnerungen die sonst so bodenständige Frau. Und wenn der Wind so wie jetzt über die Sümpfe strich, kam ihr der Nebel vor wie Geister, die über das Gras tanzten.
Donner grollten, dunkel und unheimlich. Sie zog den Reißverschluss ihres Sweaters weiter zu und wandte ihren Blick den tief hängenden Wolken zu. Das Wetter änderte sich schnell im Küstengebiet von South Carolina, und eine Wetterfront wie diese konnte einen plötzlichen Wolkenbruch mit sich bringen oder starke Böen. Sie wirkte immer noch beunruhigt, als sie auf dem Absatz kehrtmachte und über die gewienerten Dielen ihres Hauses lief – durch die große luftige Küche, das überfüllte Anrichtezimmer, das Speisezimmer mit funkelndem Kristall und Spiegeln, durch den Salon mit seinen alten Möbeln und dann direkt auf die vordere Veranda. Mit den Händen am Geländer beugte sie sich weit vor und blinzelte, während sie die Allee mit ihren jahrhundertealten Lebenseichen in ihrer ganzen Länge absuchte.
Ihre Miene erhellte sich, als sie eine Gestalt mit schneeweißem Haar die Auffahrt hinaufkommen sah, einen hageren schwarzen Hund an der Seite. Mama June lehnte sich gegen die Säule der Veranda und atmete auf. Bei dem Tempo würde Preston das Haus erreichen, bevor der Sturm losbrach. Seit wie langer Zeit wartete und schaute sie eigentlich schon, wie ihr Mann von den Feldern nach Hause zurückkehrte? Du liebe Güte, konnten es wirklich bereits an die fünfzig Jahre sein?
Preston Blakely war rein äußerlich kein großer Mann, aber seine Umgangsformen und seine Persönlichkeit machten ihn für jeden zu einer eindrucksvollen Erscheinung. Man fand, er sei beeindruckend im öffentlichen Gespräch und dickköpfig im privaten – und sie konnte dem nicht widersprechen. Sein zielstrebiger Gang hinterließ Fußstapfen auf dem sandigen Weg, seine Arme schwangen im Takt. Das hervorstehende Kinn durchschnitt den Wind wie der Mast eines Schiffes.
Himmel, was ging in diesem Mann wohl jetzt vor?, dachte sie mit bangem Kopfschütteln.
Als er das große weiße Haus fast erreicht hatte, schickte er den Hund mit einer Bewegung seines Zeigefingers fort. “Ab jetzt. Nach hinten, Blackjack”, befahl er, und sein Blick begegnete dem Mama Junes, als er den Kopf hob.
“Verdammt”, grollte er lauter als der Donner, erhob den Arm und wedelte mit einer Hand voll zerknitterter Papiere in seiner Rechten. “Diesmal haben sie’s wahr gemacht.”
Mama Junes Hand umschloss das Geländer fester, als ihr Mann die Stufen zur Veranda hinaufkam. “Was wahr gemacht?”
“Sie haben mich beim Wickel”, schimpfte er, als er die Veranda erreicht hatte.
“Wer denn, Liebling?”
“Die Banken!”, wütete er weiter. “Die Steuern. Die ganze verdammte Wirtschaft meine ich!”
“Setz dich einen Moment, Press, bevor du noch einen Herzschlag bekommst. Schau dich an, du schwitzt ja unter deiner Jacke. Es ist viel zu warm für diese Aufregung. Ich verstehe doch sowieso nicht, wovon du überhaupt sprichst. Steuern, Banken und am Wickel …”
“Ich spreche von diesem Haus hier!”
“Du musst nicht schreien. Ich bin alt, aber nicht taub.”
“Dann hör gut zu, was ich dir zu sagen habe. Sie werden es uns wegnehmen.”
“Was? Unser Land?”
“Ja, Ma’am, das Land”, erwiderte er. “Und dieses Haus, das du so sehr liebst. Das werden sie uns alles wegnehmen.”
“Press”, antwortete sie und rang nach Fassung, “ich verstehe nicht … wie können sie uns alles wegnehmen?”
Preston lehnte am Geländer und blickte über sein Land. Eine kühle Brise strich über das Gras, das sich wie die Wellen des Meeres sanft im Wind bog.
“Du weißt doch, dass wir vor ein paar Monaten neu veranlagt wurden”, begann er und fuhr fort, als sie nickte. “Und hier schreiben sie, was dieser Besitz jetzt wert ist. Und da schreiben sie, was wir jetzt zahlen sollen. Komm”, sagte er und wedelte mit den Papieren vor ihrer Nase umher. “Lies und weine.”
Mama June griff nach den zerknitterten Blättern und faltete sie behutsam auseinander. Ihr Mund blieb offen stehen vor Schreck, als sie las. “Aber … Das kann nicht stimmen. Das ist ja dreimal so viel wie vorher!”
“Viermal so viel.”
“Das können wir uns doch gar nicht leisten! Wir müssen Einspruch erheben. Sie können uns nicht zwingen, das einfach so hinzunehmen!”
“Sie können, und sie werden es.”
“Es wird eine Menge Leute hier in der Gegend geben, die das nicht hinnehmen werden”, sagte Mama June und hörte die Entrüstung, die aus ihrem Innersten kam, in ihrer Stimme. “Das kann doch nicht nur uns allein passieren.”
“Da hast du wohl recht. Es ist überall dasselbe. Und man kann nichts dagegen unternehmen. Es kommen nun mal immer mehr Leute hierher”, er zuckte die Achseln, “und sie alle wollen hier am Wasser wohnen. Wegen der tollen Aussicht. Bloß reicht das Land hier nicht für alle. Also gehen die Bodenpreise immer weiter nach oben und Immobilienspekulanten wie meine liebe gierige Schwester vertreiben sich die Zeit damit, auf den richtigen Moment zu warten. Sie werden jeden einzelnen Quadratzentimeter verschleudern, damit die ganze Gegend zubetoniert werden kann.” Er fuhr sich mit den Fingern durch die dichten weißen Haare. “Verflucht, ich wusste doch, dass das irgendwann kommen würde – wir wussten es alle. Schätze, wir haben nur nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde.”
Er lächelte sie traurig an. “Es kommt beinahe wie ein Hurrikan über uns, oder? Tja”, sagte er resigniert, “sieht so aus, als hätten wir uns diesmal verrechnet. So wie damals bei Hugo.”
“Wir haben es immer irgendwie hingekriegt. Der Krieg, die Ölkrise, die Wirtschaftsflaute, sogar Hurrikan Hugo haben wir überlebt.”
“Ich weiß. Ich habe immer getan, was ich konnte – Gott weiß, wie sehr ich gekämpft habe. Aber jetzt bin ich alt. Und ausgelaugt. Ich kann es einfach nicht mehr mit jedem Gegner aufnehmen.”
Mama June machte einen Schritt auf ihn zu und legte ihre Hand auf seine hängende Schulter, zutiefst erschrocken über den ungewohnten Anblick ihres Mannes, der mit einem Mal seinen ganzen Widerstand aufgegeben zu haben schien. Sie wollte schon etwas Banales sagen wie “Keine Bange, wir kriegen das schon hin”, als sie spürte, wie sich unter ihrer Hand seine Schulter wieder straffte. Eine neue Welle der Wut brach nun aus ihm heraus.
“Wäre dieser Nichtsnutz von unserem Sohn hiergeblieben, wären wir nicht in diesen Schlamassel geraten.”
Mama June nahm ihre Hand weg und schlang die Arme um ihren Körper. “Lass es uns nicht auf Morgan schieben …”
“Fang gar nicht erst an, ihn wieder zu verteidigen”, unterbrach er und fuhr herum, um ihr direkt ins Gesicht zu schauen. “Nicht mit mir! Er ist mein Sohn, verdammt. Er sollte hier sein und seinem Vater helfen, diese Plantage am Laufen zu halten! Es ist zu viel für einen alleine. Ich brauche seinen Einsatz, seine Ideen … Ist es zu viel verlangt, wenn ein Vater das von seinem einzigen Sohn erwartet?”
“Er muss selber seinen Platz in der Welt finden”, entgegnete sie sanft, obwohl sie spürte, wie sich alles in ihr sträubte. Diese Auseinandersetzung kannte sie nur zu gut.
“Zur Hölle mit der Welt! Er wird hier in Sweetgrass gebraucht. Hier gehört er her. Es ist schließlich sein Erbe! Seit acht Generationen wird diese Plantage von den Blakelys geführt, und auch wenn nur noch ein paar hundert Hektar übrig geblieben sind, ist Sweetgrass doch bei Gott noch immer im Besitz der Blakelys!”
“Er hat sein eigenes Land”, gab sie zu bedenken.
“Sein eigenes Land?” Preston starrte sie aus aufgerissenen Augen ungläubig an. “Meinst du diese popeligen paar Hektar in der Wildnis von Montana, auf denen er sich versteckt, wenn er nicht gerade mal wieder ein paar Gesetze bricht?”
“Ach, hör auf damit! Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Er engagiert sich doch nur für den Naturschutz.”
“Und wozu? Um ein paar lächerliche Bisons zu retten? Zur Hölle damit”, schnaubte er. “Überhaupt, Bisons … Als hätte er sie früher nicht wie alle anderen auch Büffel genannt.”
“Er will sie beschützen.”
“Er vergeudet seine Zeit. Er bewirtschaftet dieses Land nicht. Er arbeitet nicht. Punkt.”
“Hör auf, Press.” Seine wütenden Worte ließen sie fast ihre Fassung verlieren.
“Vergeudete Zeit”, grollte er weiter, ohne auf sie zu achten.
Sie wandte sich ab und ging davon. “Das muss ich mir nicht anhören.”
“Wofür habe ich eigentlich all die Jahre gearbeitet?”, rief er ihr hinterher. “Das möchte ich wirklich mal wissen. An wen soll ich das alles hier eigentlich weitergeben?”
Sie blieb stehen und sah ihm direkt in die Augen. “Du hast auch noch eine Tochter.”
Preston wischte den Einwand mit einer spöttischen Handbewegung beiseite.
“Du kannst Nan nicht einfach so übergehen”, fügte sie hinzu.
“Hat sie uns nicht genau dasselbe angetan, als sie ihr Land verkauft hat?”
“Ihr Mann …”
“Diese Ratte! Der hat sie doch nur wegen ihres Landes geheiratet!”
“Was für ein Unsinn!” Zwar war ihr dieser Gedanke selbst schon manchmal gekommen, aber sie hatte ihn nie ausgesprochen. “Falls du es vergessen hast: Ich habe mein Land auch verkauft, als ich dich geheiratet habe.”
“Das war etwas ganz anderes, und das weißt du auch.”
“Ich weiß überhaupt nichts.”
“Und da wären wir wieder. Du ergreifst immer nur für sie Partei.”
“Das ist nicht …”
“Ich bin dein Ehemann! Um mich solltest du dir Gedanken machen, wenigstens dieses eine Mal! Ich habe all die Jahre gekämpft wie ein Stier, um dieses Land zusammenzuhalten und dieses Haus zu unterhalten mit all den alten Möbeln, an denen du so hängst.”
“Wehe, du …”
“All das hier.” Sein Arm beschrieb mit einer großen Geste einen weiten Bogen. “Ich habe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschwitzt. Ich habe Blut vergossen. Ich habe mich für diesen Besitz aufgeopfert, meine Träume und meine Jugend dafür aufgegeben. Und jetzt …” Er schwieg, die Lippen zusammengepresst, und schaute über sein Land. Verzweiflung stand in seinem Blick. “Und jetzt ist alles verloren.”
“Gott sei Dank”, erwiderte sie aus tiefstem Herzen.
Preston fuhr herum und funkelte sie böse an. “Was hast du gesagt?”
“Du hast richtig gehört. Ich sagte: Gott sei Dank. Gottlob!”, rief sie wie mit fremder Stimme. In seinen blassblauen Augen sah sie den Schock und den Schmerz über das, was sie gerade gesagt hatte. Aber anstatt es zurückzunehmen oder abzumildern, wie sie es so oft getan hatte, spürte sie die Wut wie eine Naturgewalt aus sich herausbrechen.
“Du denkst immer nur an das Land, das du verlieren wirst”, fuhr sie fort und stieß ihm ihre Faust mit den zerknitterten Papieren in den Bauch. “Und was ist mit deiner Familie? Was ist mit diesem Verlust? Du hast seit Jahren nicht mit deinem Sohn gesprochen. Deine Tochter fühlt sich wie eine Aussätzige. Sie kommen nicht mehr zu Besuch hierher nach Hause. Du hast deine eigenen Kinder vertrieben! Aber das ist dir egal, oder? Dir geht es einzig und allein um dieses Stück Land. Doch wer wird um uns trauern, wenn wir tot sind? Sag mir, Preston: Werden unsere Kinder um uns trauern, wenn wir nicht mehr sind?”
Sein Gesicht erstarrte, bevor er sich abwandte, um ihrem Blick auszuweichen.
Sie atmete durch, um wieder zu Kräften zu kommen, und ging auf ihren Mann zu, bis sie dicht voreinander standen. Sie schlug sich mit der Hand auf die Brust, betonte jedes einzelne Wort und sagte mit leichtem Zittern in der Stimme: “Dieses Land hat mir meine Kinder genommen. Und das ist für mich der viel größere Verlust. Gott sei Dank, sage ich. Zum Teufel mit diesem Stück Land!”
“Das meinst du nicht wirklich ernst.” Prestons Stimme klang tief und heiser.
Mama June sah eine ganze Weile über die Landschaft, die sie seit fast fünf Jahrzehnten ihr Zuhause nannte. In der Ferne schoben sich die zerrissenen Wolken wie ein Vorhang zusammen. Dann sah sie ihren Mann an und hielt seinem Blick stand.
“Doch, das tue ich. Seit ich meinen Fuß auf diese Erde gesetzt habe, hat mir dieses Land nichts als tiefsten Kummer gebracht.”
Auge in Auge standen sie einander gegenüber und erinnerten sich schweigend an die Erlebnisse vergangener Jahre, die durch Mama Junes Worte mit einem Mal einen bitteren Beigeschmack bekommen hatten.
Und dann brach um sie herum der Sturm los. Dicke Regentropfen prasselten auf den ausgedörrten Boden, und der Regen wurde immer dichter und lauter. Mit jedem Windstoß wogten die Gräser und erzitterten. Und dann öffneten sich die Wolken, und der Himmel weinte. Die Veranda konnte sie gegen solche Wassermassen nicht schützen, und beide spürten, wie der Regen ihnen ins Gesicht peitschte.
Mama June bezweifelte, dass der Regen die Tränen verbarg, die unentwegt über ihre Wange rannen. Aber Preston rührte sich nicht, um sie zu trösten oder ein Wort des Zorns oder der Versöhnung zu äußern. Sie ließ die Schultern sinken und flüchtete ins Haus.
Preston blieb wie ein Fels in der Brandung stehen und sah sie davongehen. Er bewegte sich nicht, als er ihre Schritte auf der Treppe hörte, und wusste, dass sie in ihr Schlafzimmer ging. Sie würde sich wahrscheinlich für Stunden einschließen, womöglich sogar für den Rest des Abends, und ihn nicht an sich heranlassen.
So wie immer.
Er würde ihr nicht nachgehen. Er würde nicht versuchen, mit ihr zu reden, weil nur wieder die Vergangenheit hochkommen würde. Das konnte sie nicht ertragen – und er war sich selbst nicht mehr sicher, ob er das noch konnte. Außerdem musste er befürchten, dass sie sich weiter zurückziehen würde, an einen Ort, wo er sie noch weniger erreichen konnte als in ihrem Schlafzimmer.
Er legte die Hände auf die Hüften und ließ seinen Kopf sinken. “Mary June …” Er seufzte tief, als ihm der Name über die Lippen kam. Er war wütend geworden, und das bedauerte er jetzt. Sie war empfindlich, sobald es um Familienangelegenheiten ging. Preston hatte schlechte Nachrichten deshalb vor ihr geheim gehalten, wenn es ging. Aber dies hier … Er zerknüllte die Papiere in seiner Faust. Diesmal war es einfach zu dick gekommen. Das konnte er nicht alleine durchstehen. Verflucht noch mal, er musste diese Last mit jemandem teilen – und mit wem, wenn nicht mit der eigenen Frau? Sie war schließlich seine Frau, oder?
Er schaute ein letztes Mal zu ihrem Zimmer hinauf, in dem sie weinend lag, und fühlte einen plötzlichen Schmerz, der wie ein Blitz direkt durch sein Herz jagte.
“Zur Hölle damit!”, brüllte er und warf die verfluchten Papiere hinaus in den tobenden Sturm.
Der Wind nahm die Zettel als Beute und trug sie rascher zu den Sümpfen als ein Rundschwanzsperber. Sie verfingen sich in den niedrigen Gräsern, wo der Regen auf sie niederprasselte. Immer schwärzer wurde der Himmel, den grelle Blitze kurzzeitig erhellten, aber als ein grollender Donner ertönte, war Preston bereits ins Haus gegangen, auf der Suche nach einem Schluck Brandy.
Auf seinem Weg vom Festland aufs Meer hinaus blieb der Sturm nicht lange, und bald war die Luft wieder frisch, und die Pastellfarben des Sonnenuntergangs wurden zu einem kräftigen Ocker. Mit feuchten Sachen saß Preston auf der kühlen Veranda und starrte in den purpurnen Himmel, während der Brandy seine Wirkung tat. Normalerweise leistete ihm Mama June in ihrem Schaukelstuhl ebenso ruhige wie angenehme Gesellschaft, aber diesmal vermisste er sie schmerzlich.
“Wenigstens du hältst noch zu mir, was, mein Junge?”, sagte er und streckte den Arm aus, um seinen schwarzen Labrador zu streicheln, der zusammengerollt zu seinen Füßen lag. Blackjack hatte sich auf die Veranda geschlichen, sobald Mama June gegangen war, und sah Preston aus seinen dunklen sanften Augen hingebungsvoll an, während sein Schwanz mitfühlend auf den Holzboden klopfte. “Guter alter Blackjack.”
Mit einem schweren Seufzen wanderte Prestons Blick zur untergehenden Sonne. In den vergangenen Jahren hatte er diese letzten Stunden des Tages lieb gewonnen, wenn er friedlich im Schaukelstuhl saß und zusah, wie die Sonne über Sweetgrass unterging – im Bewusstsein, dass der Besitz der Blakelys wenigstens einen weiteren Tag intakt überlebt hatte. Einstmals war der Besitz über 600 Hektar groß gewesen, aber über die letzten 300 Jahre waren drei Viertel des Landes verkauft worden. Als letzter männlicher Blakely hatte er es immer als seine Pflicht angesehen, diesen Rest zusammenzuhalten, damit die Blakelys ihr Zuhause behalten würden. Der Gedanke daran erfüllte ihn normalerweise mit tiefer Befriedigung.
Doch an diesem Abend gab es nichts, das ihm Befriedigung verschafft hätte. An diesem Abend kam es ihm vor, als wäre all sein Bemühen vergeblich gewesen.
Mama Junes Worte hatten ihm einen unerwarteten Stich versetzt. Sie machten alle Hoffnung zunichte, die er tief in seinem Innern bewahrt hatte: dass eines nicht zu fernen Tages sein verlorener Sohn zurückkehren würde. Auch wenn er es nie jemandem erzählt hatte, so sah er diesen Traum Abend für Abend in den trügerischen Schattierungen der untergehenden Sonne. In diesem Traum verhielt er sich wie der Vater, von dem er in der Bibel gelesen hatte. Er sah seinen Sohn die Straße heraufkommen und lief ihm mit weit ausgestreckten Armen entgegen. Er richtete ein großes Fest aus, mit Musik und Köstlichkeiten – alles um die Rückkehr seines geliebten Sohnes nach langen Jahren nutzloser Wanderung zu lobpreisen. In seinem Traum lächelte er dann Mama June an und sagte: “Mein Sohn war verloren, aber er ist gefunden worden.”
Prestons Kummer wuchs. Heute Nacht konnte er seinen Traum in den Farben des Sonnenuntergangs nicht sehen. Denn mit der untergegangenen Sonne war auch seine letzte Hoffnung dahin, und zurück blieb nur kalte dunkle Einsamkeit. Er kam sich vor wie tot und begraben, als Mama Junes Worte ihm wieder einfielen: Werden unsere Kinder um uns trauern, wenn wir nicht mehr da sind?
Sie werden es nicht tun, dachte er bitter. Und dann kippte er den Rest seines Drinks hinunter.
Schwer stützte er sich auf die Armlehnen seines Stuhls, erhob sich und begann zu wanken, als ihn ein Schwindel überkam. Zu viel Brandy, dachte er, als er die Veranda entlangtrottete. Drinnen umfing ihn die Wärme des Hauses. Ein Blick auf die Standuhr sagte ihm, dass er mehrere Stunden draußen gesessen hatte, kein Wunder also, dass er so durchgefroren war. Als er sich der Treppe näherte, spitzte er die Ohren und lauschte, ob aus Mama Junes Schlafzimmer ein Laut zu hören war. Aber alles war still. Sie musste längst eingeschlafen sein, dachte er und bedauerte, dass er wohl kaum noch mit einem Abendessen rechnen konnte.
Doch in Wahrheit war er auch gar nicht hungrig. Der Streit und das anschließende Trinken hatten ihm den Appetit gründlich verdorben. Außerdem war er viel zu unruhig zum Essen. Nach einem Streit mit Mama June hatte er immer Mühe, sich zu beruhigen. So lange, bis sie sich wieder versöhnt hatten. Diese Frau hatte sein Herz in der Hand, und er fragte sich, ob ihr das überhaupt klar war. An manchen Tagen schien sie seine Anwesenheit nicht einmal richtig zu spüren.
Er spürte seine Einsamkeit sehr genau. Sie pochte in seinem Kopf mit dem Rhythmus seines Blutes. Er zog seine Jacke aus, ließ sie über einen Stuhlrücken fallen und lief unruhig umher. Mit schweren Füßen schleppte er sich vorwärts, und seine müden Augen nahmen kaum das Zimmer wahr, in dem er sich befand. Er konnte an nichts anderes denken als an Mama Junes Worte.
Zur Hölle mit diesem Stück Land!
Hatte sie das wirklich so gemeint?
Seit ich meinen Fuß auf diese Erde gesetzt habe, hat mir dieses Land nichts als tiefsten Kummer gebracht.
Der Tag, an dem Mary June Clark zum ersten Mal ihren Fuß auf diese Erde gesetzt hatte, hatte sich ihm tief ins Gedächtnis eingegraben. Sein junges Herz hatte solch eine Vernarrtheit nie zuvor erlebt, und später, viel später war diese Vernarrtheit zu der tiefen Hingabe eines Mannes geworden.
Preston hatte Mama June noch nie so sprechen gehört. Meinungen wie diese behielt sie üblicherweise für sich, weil sie andere nicht gerne vor den Kopf stieß. Aber diese Worte … Sie waren wie aus einer tiefen verborgenen Quelle an die Oberfläche gesprudelt. Einer sehr tiefen, dachte er und verzog das Gesicht. Wie hatte Faulkner einmal geschrieben? Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist noch nicht einmal vergangen. Es brach ihm fast das Herz zu denken, dass all seine Bemühungen vergeblich gewesen waren. Kein Mann konnte das ertragen.
Bei jedem Gang durch das Haus schenkte er sich noch einen Drink ein. Nach einem weiteren ging er zu einem Tischchen aus Mahagoni in der Halle und kramte Mama Junes blaues Adressbuch hervor. Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen, und er suchte nach seiner Lesebrille – diese Fehlsichtigkeit war eine Begleiterscheinung des Alterns, die er nie akzeptiert hatte. Nach einer kurzen Suche zwischen ihren schwungvoll geschriebenen Eintragungen nahm er den Hörer ab und wählte eine Nummer in Montana.
“Hi, hier ist Morgan. Ich bin leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine kurze Nachricht, ich werde dann sofort zurückrufen.”
Preston war nicht vorbereitet darauf, nach so vielen Jahren des Schweigens plötzlich wieder die Stimme seines Sohnes zu hören. Er nestelte einen Moment an der Telefonschnur herum. Seine Zunge fühlte sich ungewohnt schwer an. Als der Signalton kam, dauerte es noch einen Moment, bis es aus ihm herauskam: “Äh, Morgan, hier ist dein Vater. Ich, äh …” Preston war mit einem Mal verwirrt und suchte verzweifelt nach Worten, die seinen Gedanken Ausdruck verliehen. “Ich rufe an, weil … weil ich mit dir reden will. Na ja, ich …” Das ging nicht gut, er hörte besser auf. “Na, dann mach’s gut, mein Junge.”
Prestons Hand zitterte, als er den Hörer auf die Gabel legte. Er lehnte sich an das Tischchen und keuchte, als hätte er gerade den großen Acker mit eigenen Händen gepflügt. Verdammt, er schwitzte sogar! Was für ein Pech, dass sich bei seinem ersten Anruf nach all den Jahren ein Anrufbeantworter gemeldet hatte.
Die Traurigkeit in seinem Herzen ließ seine Brust eng werden. Das Atmen fiel ihm immer schwerer, und er fühlte sich schwach, kaum fähig, sich auf den Beinen zu halten. Er stieß sich von dem Tischchen weg, richtete sich auf und fühlte, wie ihn ein leichter Schwindel überkam, als könnte er jeden Augenblick ohnmächtig werden. Er stolperte hinaus auf die Veranda, um sich mit ein paar tiefen Zügen kühler Meerluft zu erholen.
Beim Geräusch der Tür erhob sich Blackjack von seinem gepolsterten Lager und kam schwanzwedelnd auf sein Herrchen zu.
“Geh zurück, Junge”, murmelte er und ging an ihm vorbei. Der Hund jaulte und drückte seine Schnauze an sein Bein.
“Zurück”, brüllte er und riss die Arme in die Luft. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und griff panisch nach etwas – irgendetwas –, das ihm Halt geben könnte. Sein Blick verschwamm, und mit erschreckender Schnelligkeit war er nur noch von Dunkelheit umgeben. Das Pochen in seinem Kopf schwoll an zu einem ohrenbetäubenden Hämmern und wurde immer lauter und lauter. Er ging zu Boden. Seine Arme reckten sich dem Haus entgegen, als er auf den Boden schlug. Jäh schien ein Blitz sein Gehirn zu treffen, durchfuhr ihn und lähmte seine Muskeln. Als der Schmerz unerträglich war, wurde es um ihn herum weiß.
“Mary Ju…”
Das Weiß wurde zu Schwarz. Dann war alles still.
2. KAPITEL
Sweetgrass (Muhlenbergia filipes) ist eine einheimische, hochgewachsene Pflanze, die in Büscheln entlang der Küstendünen von North Carolina bis nach Texas wächst. Diese einheimische Pflanze verschwindet immer schneller aus der Landschaft, weil die Verstädterung und Entwicklung der Küstengebiete und des Sumpflandes der Pflanze ihren natürlichen Lebensraum nimmt.
Als er das verzierte schmiedeeiserne Gitter erreichte, drehte der Motor des Pick-ups lautstark durch. Ganz oben auf dem Tor stand kunstvoll verschnörkelt ein einziges Wort: Sweetgrass. Der Wagen vibrierte im Takt des durchdrehenden Motors, aber das Beben in Morgan Blakelys Herz hatte einen anderen Grund.
Die Wagentür quietschte in ihren Angeln, als er sie öffnete. Der Wind wehte einen Hauch Süße in die abgestandene Luft des Wageninneren und blies die Lethargie seiner Fahrt davon. Mit einer weiteren Bewegung setzte er zum ersten Mal seit über zehn Jahren einen Fuß auf die Erde des Lowcountry. Er streckte die steif gewordenen Schultern in seiner Jeansjacke. Mit geschlossenen Augen reckte er sein Gesicht der feuchtklaren Morgenluft entgegen, gähnte herzhaft und fuhr sich mit schwieligen Handballen durch das Gesicht. Nach über vierzig Stunden Autofahrt können einem schon mal die Knochen wehtun, dachte er. Er konnte noch immer den Asphalt unter seinen Füßen spüren. Kein Wunder. Es waren allein 850 Meilen auf der I-90 gewesen, um die Grenze von Montana zu erreichen.
Er hatte gar nicht damit gerechnet, dass seine alte Mühle die Reise überstehen würde, aber der Chevy war unbeirrbar über die Straßen getuckert wie ein Hund, der zu seinem warmen Zuhause trottete. So etwas wird heute gar nicht mehr gebaut, dachte er und gab dem verdienten grauen Kasten einen respektvollen Klaps. Er hatte ihn gekauft, als er einundzwanzig war, und aus lauter Stolz jede Menge Geld hineingesteckt. Eine Anhängerkupplung, eine Winde mit Aufspulvorrichtung, einen Werkzeugkasten und natürlich eine wattstarke Stereoanlage. Damals brannte ihm jeder Cent ein Loch in die Hosentasche. Doch er träumte vom großen Abenteuer und hatte genug Wut und Aufbegehren in sich, um seinen eigenen amerikanischen Traum immer wieder anzuheizen. Er hatte genau diese Straße genommen, hatte das Gaspedal voll durchgetreten und sich kein einziges Mal umgedreht.
Es war eine lange beschwerliche Reise gewesen. Jetzt, Jahre später, waren seine Reifen abgefahren und die Lautsprecher längst kaputt. Vor der Abfahrt in Montana hatte er seine spärlichen Ersparnisse eingesteckt – gerade genug für die Fahrt nach Hause.
Nach Hause. Morgan betrachtete die undurchdringliche Wand von Büschen und Bäumen, die das Familienanwesen vor neugierigen Blicken Vorbeifahrender auf der Route 17 schützte. Ein heruntergekommener Graben verlief entlang der Straße – wie ein Burggraben, dachte er und kickte missmutig ein paar Kieselsteine weg. Er lief zum Tor und öffnete es, und kurz darauf fuhr er auf den Besitz seiner Familie.
Das Sonnenlicht fiel auf die Straße, als er seinen Wagen langsam den Weg entlangsteuerte. In den Bäumen rundherum begrüßten Vögel und Eichhörnchen lautstark den beginnenden Tag, und eine erschrockene Wachtel flog kreischend auf. An jeder Biegung brachte eine neue Ansicht Erinnerungen zurück, die er lange Zeit verdrängt hatte. Er sah die kläglichen Überreste der Räucherei, in der zur Kolonialzeit das Fleisch haltbar gemacht wurde. Nur ein Stück weiter lagen an einem unterirdischen Wasserlauf die Fundamente der ehemaligen Molkerei. Im kalten Wasser waren damals Milch und Käse gekühlt worden. Dort hatten die Kinder der Blakelys besonders gerne gespielt.
Noch weiter in Richtung des westlichen Endes lag ein großer Obstgarten mit Pfirsichbäumen. Morgan wurde unwohl angesichts des schlechten Zustandes der einstmals makellos gepflegten Felder. Noch ein Stück die Straße hinauf lag hinter den Bäumen eine große Lichtung mit gemähtem Gras, auf der sich die Gemeinde an Sonntagen zum Picknick mit Truthahnspießen und gegrillten Austern oder anderen Anlässen traf.
Als er die letzte lange Kurve nahm, musste er anhalten. Unter ihm tuckerte der Motor, als er sich nach vorn auf das Lenkrad lehnte. Das plötzliche Gefühl von Heimweh, das der Anblick in ihm auslöste, überraschte ihn.
Vor ihm im Dunst des anbrechenden Tages erstreckte sich die eigentliche Auffahrt zu seinem Elternhaus. Massive Lebenseichen mit Moosbewuchs säumten die Schotterstraße. Mit ihren tief hängenden Ästen wirkten sie wie Wächter aus einer fernen besseren Zeit. Wenn der Straßengraben der Festungswall dieses Königreiches ist, überlegte er, dann sind diese edlen Eichen seine Ritter.
Am Ende der langen Allee erwartete ihn das Plantagenhaus im typischen Kolonialstil wie eine reizende Südstaatenschönheit – zierlich, hübsch und Wärme verheißend. Sein Vater hatte dieses Haus immer geliebt wie eine Frau – seine schlanken weißen Säulen, das tief heruntergezogene holländische Walmdach, die eleganten Bögen der Mansardenfenster mit ihren hübschen Scheiben. Das Fundament war aus Backstein und festem Kalkstein, gebaut für Generationen.
Und die hatte es auch überstanden. Das Haus hatte zwei Jahrhunderte mit Stürmen, Kriegen, Tragödien und anderen Unbilden hinter sich gebracht, es war geradezu unverwüstlich. Ein Haus mit Stehvermögen, so hatte es sein Vater oft liebevoll bezeichnet.
Plötzlich ging die Haustür auf, und eine zarte Frau mit Haaren so weiß wie die Fassade trat auf die Schwelle. Sie trug einen hellblauen Morgenmantel, den sie mit fröstelnden Fingern unter dem Kinn zusammenhielt. Morgan schluckte schwer, als er sie da stehen sah. Wieso war ihm nie aufgefallen, dass seine Mutter diesem Haus so sehr ähnelte? Ob seinem Vater derselbe Vergleich unzählige Male in den Sinn gekommen war?
Morgan nahm langsam die letzte Kurve und hielt vor dem Haus an. Blackjack jagte um die Ecke von der Veranda und sprang die Stufen herunter, den Schwanz in die Höhe gereckt und laut bellend. Morgan stellte den Motor ab, und der Wagen machte noch einen Satz, bevor er endlich zum Stehen kam.
Seit wann hat sie so weißes Haar?, überlegte er. Und seit wann ist sie so zerbrechlich, als könnte ein leichter Windstoß sie umpusten? Die Jahre, die zwischen ihnen lagen, erschienen ihm wie eine Ewigkeit, als er durch die Windschutzscheibe starrte und nachrechnete, wie alt seine Mutter jetzt war: sechsundsechzig Jahre.
Auch der schwarze Labrador war alt geworden. Blackjack lief auf steif gewordenen Beinen, und seine Schnauze war längst weiß, aber sein Bellen konnte noch immer Tote erwecken. Morgan machte die Tür auf. Sofort lief der Hund heran, mit gesenktem Kopf, zurückgelegten Ohren und aufgeregt schnuppernd.
“Hey, Blackjack”, flüsterte Morgan und streckte langsam die Hand aus, als seine Beine den Boden berührten. “Kennst du mich noch?”
Als er die Stimme hörte, kam der Hund einen Schritt näher und kam mit seiner Schnauze dicht an die ausgestreckte Hand. Ein Ausdruck der Erinnerung trat in die trüben Hundeaugen, und mit einem Mal begann Blackjack, vor unbändiger Freude gleichzeitig zu bellen und zu jaulen.
“Morgan!”
Die Stimme seiner Mutter übertönte Blackjacks Bellen. Für einen kurzen Moment schloss Morgan die Augen, stand langsam auf und schaute über seine Schulter zu ihr hinüber. Sein Blick traf auf glänzende blaue Augen, die ihn durch einen Tränenschleier musterten. Sie hatten sich eine lange Zeit nicht gesehen. Für einen Moment standen Mutter und Sohn einfach da und blickten sich schweigend an, bis sie ihre Arme weit öffnete und mit unsicheren Schritten auf ihn zukam.
Morgan wischte sich die Hände an seinen Jeans ab und war mit ein paar langen Schritten bei ihr. Mama June umarmte ihn mit zitternden Armen, und sofort war Morgan wieder von ihrem Duft nach Gardenien eingehüllt.
“Ach, mein lieber, lieber Junge!”, weinte sie. “Es tut so gut, dich zu sehen. Schäm dich, dass du so lange weggeblieben bist. Du hast mir so gefehlt!”
Sie konnte seinen Widerstand spüren, konnte spüren, wie er sich versteifte, und das tat ihr sehr weh, aber trotzdem hielt sie ihn noch einen Moment lang fest, als wäre ihre Liebe stark genug, um sein Eis zu schmelzen.
Er fühlte sich unwohl bei diesem Gefühlsausbruch, zog sich ein Stückchen zurück und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
“Hallo, Mama June.”
Lächelnd hielt sie ihn auf Armeslänge von sich. “Schatz, lass mich dich anschauen. Du bist ja so dünn geworden! Bekommst du nicht genug zu essen?”
“Ich esse genug.”
“Darauf würde ich nicht wetten wollen. Aber keine Sorge, wir kümmern uns darum, solange du hier bist.”
Während sie ihn anstrahlte, musterte auch er sie ausführlich. Sie war irgendwie anders. Mama June war stets schlank gewesen, aber über die Jahre war sie ein bisschen rundlich und ihre Haut weicher geworden. Sie sah verschlafen aus, und er vermutete, dass Blackjacks Bellen sie geweckt hatte. Aber sie wirkte nicht wirklich müde – das Wort passte nicht. Älter. Und das erschreckte ihn.
In seiner Erinnerung hatte seine Mutter immer so ausgesehen wie zu dem Zeitpunkt, als er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Sie war eine mädchenhafte Frau gewesen, mit glänzenden Augen, die vor Neugierde sprühten, und mit schnellen, wenn auch geschmeidigen Bewegungen, aus denen ein wacher Geist sprach. Ihre Haare trug sie seit jeher lang, doch sie waren schneeweiß geworden und locker zusammengebunden zu einem dünnen Zopf, der ihr über die Schulter fiel. Das ließ sie gleichzeitig altmodisch und wie ein junges Mädchen aussehen.
Natürlich hatte er gewusst, dass sie älter geworden war. Schließlich war er jahrelang nicht zu Hause gewesen. Aber es zu wissen und zu sehen waren zwei ganz unterschiedliche Dinge. Trotzdem, die Aufregung zauberte eine jugendliche Röte auf ihre hohen Wangenknochen, ihr freudiges Lächeln brachte Grübchen zum Vorschein, und ihre blauen Augen funkelten wie ein helles Licht in einem Fenster.
Mama June lächelte glücklich. “Ich … ich kann es gar nicht glauben, dass du hier bist. Welcher Segen! Ein echter Segen. Oh, Morgan, was für eine Überraschung! Warum hast du denn nicht angerufen und dich angekündigt?”
“Ich wollte keine Mühe machen. Ich dachte, du hast zurzeit genug zu tun wegen Daddy.”
Ihr Lächeln erstarb. “Du hast meine Nachricht bekommen?”, fragte sie leise.
Morgan nickte. “Und ich habe mit Nan gesprochen.”
Mama June sah verwirrt aus. “Nan? Deine Schwester hat mir gar nicht erzählt, dass sie mit dir geredet hat.”
“Ich habe sie darum gebeten. Ich wollte keine Heimlichkeiten oder so was in der Art. Doch ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte und, na ja, ich wollte …”
“Mir keine Hoffnungen machen?”
Er lachte verlegen und scharrte mit den Füßen. “Ja, wahrscheinlich.”
Sie zog ihre Augenbrauen zusammen. “Und wann hast du dich entschieden herzukommen?”
Die Frage schien ihn zu überraschen. “Ich musste einfach kommen. Ich weiß, es war nicht alles in Ordnung zwischen uns, aber verdammt, er ist schließlich immer noch mein Vater.”
“Ach, Morgan, es tut mir so leid, dass ich es dir nicht selber sagen konnte. Ich habe versucht, dich anzurufen, nachdem dein Vater ins Krankenhaus gebracht worden war, doch ich habe dich nicht erreicht. Ich habe es weiter versucht und dann irgendwann eine Nachricht hinterlassen. Es ist mir schwer gefallen, dir aufs Band zu sprechen. Ich bin froh, dass Nan dich angerufen hat.”
“Sie hat mich nicht angerufen. Ich habe sie angerufen. Nachdem ich Daddys Nachricht abgehört hatte.”
Mama June zuckte zusammen, und ihre Augen wurden groß. “Seine … seine was? Preston hat dich angerufen? Wann denn?”
“Vor etwas über einer Woche. Aus heiterem Himmel. Wie es der Zufall wollte, war ich auf einem Jagdausflug und habe die Nachricht erst eine Woche später abgehört.” Er machte eine Pause und lachte kurz. “Als ich seine Stimme gehört habe, musste ich mich erst mal setzen, das kann ich dir sagen. Ich habe die Nachricht wieder und wieder gehört, weil ich gar nicht fassen konnte, dass das wirklich mein alter Herr war. – Kurz darauf habe ich deine Nachricht bekommen.” Er schwieg. “Das hat wirklich gesessen. Ich habe mir einfach eine Karte genommen und alles Geld, das ich auftreiben konnte, habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Süden gefahren.”
Mama June starrte ihren Sohn ungläubig an. “Preston hat dich angerufen …”
“Hast du das nicht gewusst?”, fragte Morgan überrascht.
Sie schüttelte den Kopf. “Was wollte er denn?”
“Ich dachte, das könntest du mir erklären. Er war vage, stotterte fast, als wüsste er gar nicht, was er sagen soll. Am Ende meinte er, er wolle reden, und danach hat er sich verabschiedet und aufgelegt.”
Morgan konnte sehen, wie eine Welle verschiedenster Gefühle seine Mutter ergriff, als sie einen Moment ins Leere starrte, mit einer Fingerspitze am Mund. Ihm fiel ein, wie zartfühlend sie war, und er hätte sie fast in den Arm genommen. “Bist du in Ordnung?”
“Ich? Oh ja, Schatz, mir geht’s prima”, antwortete sie so flüchtig, dass Morgan ihr nicht glaubte. Sie senkte den Kopf und sagte mit trauriger Stimme: “Es ist nur, dass dein Vater mich immer wieder erstaunt.”
“Mich hat es ja auch fast umgehauen, darauf kannst du schwören.”
Sie lachten leise. Preston Blakelys Unberechenbarkeit hatte die Familie seit jeher auf Trab gehalten – und mit einem Mal kam es Morgan so vor, als wäre er in diesem Moment, in diesem Augenblick der gemeinsamen Erinnerung ein bisschen mehr zu Hause angekommen.
“Wie geht es ihm?”
Ihr Lächeln erstarb, und aus ihrer Stimme sprach Sorge. “Nicht gut. Es war ein ziemlich schwerer Schlaganfall. Die Ärzte wissen nicht, ob er jemals wieder laufen kann. Vielleicht nicht einmal sprechen.”
Morgan fluchte leise. “Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm ist.”
“Noch viel schlimmer ist es, genau zu wissen, dass es ihn hinter der stummen Fassade schier wahnsinnig macht, ans Bett gefesselt zu sein und in diesem Krankenhaus zu liegen. Du kennst deinen Vater. Er hat nie länger als einen Tag im Bett gelegen, egal wie krank er war.”
“Das ist schon verrückt.”
“Es ist einfach unfair, nichts weiter.” Mama June zog die Kordel ihres Morgenmantels fester und atmete tief durch. “Es gibt eine Menge zu besprechen, aber hier draußen wird es in den Hausschuhen und dem Morgenmantel ein bisschen kühl. Und du brauchst etwas zu essen.” Sie schob ihren Arm unter seinen und drückte ihn sanft. “Komm rein ins Warme, ich mach dir was zum Frühstück. Du musst ja am Verhungern sein.”
“Hört sich gut an.” Morgan griff nach dem Seesack auf dem Rücksitz seines Wagens.
Sein Wagen, seine Kleidung, sogar sein Gepäck schienen voller Staub zu sein, als hätte er geradewegs die Wüste durchquert. Er war viele Meilen gefahren. Aber jetzt ist er wieder zu Hause, dachte sie, und ihr Herz wollte schier überlaufen vor Glück. Sie ging mit ihm zum Haus, und ihrem unerbittlichen Auge entging der schäbige Anblick ihres sonst so makellosen Zuhauses nicht. Prestons Krankheit hatte sie zu sehr in Anspruch genommen, als dass es ihr aufgefallen wäre. Sie sah, dass das Sitzkissen auf der Bank der Veranda voll mit Blackjacks Hundehaar war und dass sich Schmutz und Spinnweben in den leeren Blumenkästen gesammelt hatten. Es war April, und sie hatte noch immer keine Stiefmütterchen gesetzt.
Blackjack stoppte am Fuße der Treppe und sah Mama June flehentlich an.
Sie drehte sich um und zeigte auf den Korb unter der Veranda. “Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache. Sobald wir uns umdrehen, wird er sich nach oben schleichen. Das macht er so, seitdem dein Vater im Krankenhaus liegt. Wahrscheinlich hält er nach ihm Ausschau. Ich kann mich nicht erinnern, dass Preston jemals länger als einen Tag von hier weg gewesen ist.”
“Es ist so still hier, ist Nona denn gar nicht da?”, fragte Morgan.
“Du lieber Gott, nein! Nona hat sich zur Ruhe gesetzt, kurz nachdem du weggegangen bist. Sie kümmert sich hauptsächlich um ihre Körbe. Ich hab sie nicht mehr allzu oft gesehen seither, aber von Zeit zu Zeit halten wir an ihrem Stand ein Schwätzchen.”
“Das Haus war ihr wohl zu leer ohne mich, schätze ich.”
“Das war bestimmt der Grund”, antwortete Mama June und öffnete die Haustür.
Die Eingangshalle erstrahlte im Sonnenlicht, und frische Luft wehte herein. Plötzlich überkam sie die Freude einer jungen Mutter, die ihr Kind ins Haus ruft.
“Komm herein, Morgan. Willkommen zu Hause!”
Mama June hüpfte das Herz, als sie Morgan lächelnd ins Haus lotste. In der Halle standen sie einen Moment ein bisschen verlegen herum. Es entstand eine peinliche Pause. Sie entschieden sich, vor dem Frühstück noch einmal nach oben zu gehen, um sich etwas frisch zu machen. Mama June ging die weite Treppe hinauf voran und machte die Lichter an. Hinter ihr blickte Morgan mal nach links, mal nach rechts, um alles in sich aufzunehmen. Sein Blick sagte ihr, dass er bemerkt hatte, dass die einstmals glanzvoll cremefarbenen Wände die Farbe grauen Staubes angenommen hatten und dass der Seidenbezug der alten Stühle ebenso fadenscheinig geworden war wie der Saum der Vorhänge an den verblichenen Tapeten.
“Ich nehme mal an, dass Daddy immer noch jeden Penny in die Farm steckt?”, fragte er.
“Und jeden zweiten Penny hat er gepumpt”, erwiderte sie leichthin. “Plus ça change, plus c’est la même chose.”
“Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass die gute alte Beatrice die Alte geblieben ist”, scherzte er und deutete auf das Gemälde einer aufrechten Dame des 19. Jahrhunderts mit strengem Gesichtsausdruck, die ein leuchtend rotes Häubchen trug. Beatrice Blakely war eines der Gründungsmitglieder des Blakely-Clans in den Kolonien. Sie war die zweite Frau von Oliphant “Ol’ Red”, der zuvor aus Europa nach Nordamerika gekommen war.
“Hast du jemals herausgefunden, warum sie so böse schaut?”
Mama June schnaubte verächtlich. “Steuern, jede Wette. Die Steuern waren der Fluch dieser Familie seit Beatrices Zeiten. Morgan …”
Sie ließ den Satz unbeendet, denn er hatte das Schlafzimmer am Ende der Halle erreicht und öffnete die Tür.
Mama June blieb stehen, aber ihr Blick folgte ihm. Sie sah ihn ruhig dastehen, seine Tasche immer noch in der Hand, und sich in seinem alten Zimmer umschauen. Sie atmete durch und folgte ihm durch den Flur zu dem spärlich erleuchteten Zimmer.
“Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass du kommst. Ich hätte es dir ein bisschen vorbereitet.”
Sie lief geradewegs zu den Fenstern und schob mit ein paar entschlossenen Handgriffen die schweren blauen Vorhänge zur Seite. Eine Armee von Staubflusen tanzte im Sonnenlicht. Sie wischte sie zur Seite, während ihre Wangen von einem leichten Rot überzogen wurden. Dann ging sie zum anderen Fenster, öffnete die Vorhänge und machte auch dieses Fenster frei.
“Ich bin in diesen Zimmern nicht mehr sehr oft”, erklärte sie und sah sich stirnrunzelnd um. Schließlich drehte sie sich zu ihm und schüttelte den Staub von ihren Händen.
Er stand immer noch reglos da. Mit einem merkwürdigen Blick betrachtete er das eiserne Bettgestell mit der armeeblauen Patchworkdecke, auf der das gestickte Familienwappen prangte. An den Wänden hingen Bilder von den Buchten, von den Sümpfen und den Segelbooten, die er in seiner Jugend so geliebt hatte. Unter einem Fenster stand sein alter Schultisch aus Kiefernholz mitsamt Stuhl, das weiche helle Holz völlig zerkratzt. Und an seinem hohen Sekretär fehlten immer noch zwei Schubladen. Sie hatte nur eines verändert: Die kunterbunte Sammlung von Schnapsflaschen fehlte ebenso wie seine alten Poster längst vergessener Rockstars.
“Ich komme mir vor wie in alte Zeiten zurückversetzt”, murmelte er.
Ich wünschte, es wäre so, dachte sie, sagte aber nichts, während sie im Zimmer umherging, geistesabwesend einen Stuhl zurechtrückte und die Bettdecke gerade zog.
“Es ist alles noch ziemlich genau so wie an dem Tag, als du weggegangen bist. Wir wussten doch, dass du zurückkommst, früher oder später. Ich werde hier heute Nachmittag ein bisschen saubermachen.”
“Es sieht besser aus als bei mir.”
Er setzte seine Tasche ab, streckte sich ausgiebig und gähnte dabei so laut wie ein Bär, der aus dem Winterschlaf erwacht. Sein jungenhaftes Benehmen überraschte sie und erinnerte sie an jene Zeit, als der kleine Morgan mit Vorliebe herzhaft gegähnt oder lautstark gerülpst hatte, vor allem, um sie damit zu schockieren. Beim Gedanken daran musste sie ein bisschen lächeln.
“Du weißt ja noch, wo alles ist”, sagte sie und wusste nichts mit ihren Händen anzufangen, die sie am liebsten ausgestreckt hätte, um ihn zu berühren. Ihr Herz war in Aufruhr allein durch seinen bloßen Anblick – ihr Sohn hier, in seinem alten Zimmer! Aber sie wagte es nicht. Vielleicht hätte sie ihn mit einer gefühlsduseligen Geste verschreckt. Schon als Kind hatte er auf ihre Umarmungen abweisend reagiert und war ihren Küssen ausgewichen. Heute war die unsichtbare Mauer, die er um sich herum errichtet hatte, geradezu greifbar.
“Im Bad sollten frische Handtücher und Seife sein. Ich gehe noch mal nachsehen. Wir hatten so lange keinen Logiergast mehr.” Als sie merkte, dass sie ihren Sohn gerade in die Kategorie Gast eingeteilt hatte, fügte sie leise hinzu: “Aber du bist ja auch kein Gast, natürlich! Also”, sie wusste noch immer nicht, wohin mit den Händen, und faltete sie vor dem Bauch, “sag einfach Bescheid, wenn du noch irgendetwas brauchst.”
“Klar. Alles bestens, danke”, antwortete er und fuhr sich mit den Händen müde durchs Gesicht.
“Nimm dir ein bisschen Zeit und ruh dich aus, hörst du? Du siehst ziemlich erschöpft aus.”
“Vielleicht sollte ich das. Es war eine lange Fahrt.”
“Nun …” Sie suchte wieder nach Worten. “Ich kümmere mich am besten ums Frühstück.”
Als er nur nickte, ging sie hinaus und schloss die Tür leise hinter sich.
Draußen blieb sie einen Moment stehen und versuchte sich zu sammeln. Träumte sie womöglich? War Morgan wirklich gekommen? Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Es war bereits acht Uhr, und sie war noch immer im Nachthemd! Es war höchste Zeit, sich anzuziehen, dachte sie und lief schnell in ihr eigenes Zimmer am anderen Ende des Flurs.
Routiniert zog sie sich an: den üblichen khakifarbenen Rock, eine frische Baumwollbluse und bequeme Schuhe. Geschickt band sie ihren Zopf zu einem Knoten und steckte ihn mit ein paar Haarklemmen fest. Dann wusch sie ihr Gesicht mit kaltem Wasser und schminkte sich die Lippen. Sie war weder eine eitle Frau noch sonderlich interessiert an Mode. Ihre Alltagskleidung war bequem, und für besondere Anlässe verließ sie sich auf klassische Qualitätsware im zeitlosen Stil. Auch wenn die Jahre nicht spurlos an ihr vorübergegangen waren, hatte sich ihre Kleidergröße kaum geändert, und einige Sachen in ihrem Schrank stammten noch aus den ersten Jahren ihrer Ehe, als sie häufiger ausgegangen waren. Es amüsierte sie jedes Mal, wenn ihre altmodischen Kleider wieder in Mode kamen.
Nach einem kurzen Blick in den Spiegel fühlte sie sich schon sehr viel besser und gewappnet für den kommenden Tag. Sie legte ihre Freude wie ein Schultertuch um sich und machte sich an die unzähligen Aufgaben, die sie für heute im Kopf hatte.
Etwas später stand Mama June am Herd, rührte mit einer Hand in der Maisgrütze und machte mit der anderen eine Liste von all den Dingen, die sie heute zu erledigen hatte. Ganz oben auf der Liste stand, Morgans Rückkehr bei der Familie bekannt zu machen und alle für Sonntag zum Essen einzuladen. Das Sonntagsessen war seit Generationen eine Familientradition, die aber wie so vieles vernachlässigt worden war – weil ständig andere Verpflichtungen dazwischenkamen oder weil Familienmitglieder fortgezogen waren oder einfach weil sich die Prioritäten in der heutigen Zeit verschoben hatten. Inzwischen fanden die Familienessen nur noch an Feiertagen und zu besonderen Anlässen statt.
Auf jeden Fall ist Morgans Rückkehr Grund genug für ein Familienfest, dachte sie voller Vorfreude. Es musste eine Ewigkeit her sein, seit sie zum letzten Mal die Damasttischdecke über den Tisch im Speisezimmer gebreitet und die Kerzen im geputzten Leuchter entzündet hatte. Sie würde Krebssuppe mit Sherry kochen, Morgans Lieblingsessen. Und vielleicht Hühnerfrikassee, dachte sie und schrieb die Zutaten gleich auf ihre Liste.
Oh, und wie gerne würde sie wieder einmal Nonas Kekse backen. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Nonas Kekse … Die waren einfach göttlich, so leicht und zart, als würde man in Luft beißen. Sie konnte sich gar nicht mehr erinnern, wann sie sie zum letzten Mal gegessen hatte. Ab und zu ging sie bei Nonas Korbstand am Highway 17 vorbei, um ein Schwätzchen zu halten. Aber selbst das hatte sie schon eine Weile nicht mehr getan. Sie dachte mit schlechtem Gewissen an Nona, während sie ihrer Liste ein paar weitere Punkte hinzufügte.
“Irgendetwas riecht gut.”
Mama June sah auf, als Morgan in die Küche kam. Der Anblick seines geneigten Kopfes und seiner schlaksigen Figur ging ihr ans Herz. Sein dickes Haar war noch nass vom Duschen und stand nach allen Seiten ab, und das hellblaue Hemd, das so gut zu seinen Augen passte, war zwar nicht gebügelt, aber immerhin frisch gewaschen. Er sah mittlerweile etwas entspannter aus, wenn auch immer noch übermüdet und blass.
“Der Kaffee ist fertig, der Schinken steht schon im Ofen und die Tasso-Sauce dickt gerade noch ein bisschen ein”, erklärte sie gut gelaunt. “Du siehst aus, als könntest du von allem etwas gebrauchen. Na los, mein Schatz, setz dich. Der Tisch ist gedeckt. Da liegt auch die Post & Courier, falls du dich über die Lokalnachrichten auf den neusten Stand bringen willst.”
“Danke”, antwortete er und schlurfte gedankenverloren zum Tisch.
Sie summte leise vor sich hin, während sie ihrem Sohn wie damals das Frühstück zurechtmachte.
Morgen für Morgen hatte sie wie eine Henne um ihr Küken herumgewuselt, hatte ihn gedrängt, ordentlich zu essen, bevor er losstürzte – stets in Eile, weil er zu lange geschlafen hatte. Morgan war von Kindesbeinen an so dünn wie eine Bohnenstange gewesen, egal wie viel oder wie oft er gegessen hatte.
Verstohlen sah sie ihren Sohn an. Er schien so anders, und doch so vertraut. Sein Gesicht war ähnlich geschnitten wie ihres, aber seine blauen Augen waren die seines Vaters. Das braune Haar war immer noch dick und hatte einen Schnitt nötig. Und er hatte immer noch die schlanke schlaksige Figur, dachte sie und beobachtete, wie er seine langen Beine unter dem Tisch ausstreckte. Doch an Brust und Schultern konnte man erkennen, dass aus dem Jungen von einst längst ein Mann geworden war.
Ihr Herz zog sich zusammen, als sie ihm Brei, Schinken und Eier auf einen Teller häufte. “Dann erzähl mal”, begann sie schließlich die Unterhaltung. “Was ist denn so los, da oben in der Wildnis von Montana?”
“Nicht viel.”
“Ich nehme an, es gefällt dir dort?”
“Ich komme ganz gut zurecht.”
“Ich weiß gar nicht, wie du da klarkommst, so weit weg und ganz allein. Du bist so aus der Welt. Es muss doch manchmal unglaublich einsam sein dort oben.”
“Ich komm klar.”
Er wollte ihr also nicht entgegenkommen. Nun, es gab mehr als einen Weg, Informationen aus ihm herauszukitzeln. Sie machte den Ofen aus, nahm den Teller und stellte ihn vor ihn auf den Tisch.
Beim Anblick des Essens wurden seine Augen so groß wie Untertassen. Der Teller war überladen mit Essen. Selbst ein Riese hätte das nicht alles essen können – und plötzlich war es ihr selbst ein bisschen peinlich, wie offensichtlich sie Eindruck auf ihn machen wollte.
“Ich werde mein Bestes tun”, murmelte er und nahm die Gabel in die Hand.
“Ich habe es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Iss einfach, soviel du möchtest”, sagte sie und wischte sich die Hände an der Schürze ab. “Ich bringe dir noch frischen Kaffee.”
Sie goss ihm Kaffee nach und schenkte sich anschließend selbst eine Tasse ein. Damit sie nicht sinnlos herumstand und ihn anstarrte, begann sie, die Bratpfanne abzuspülen.
“Beim letzten Mal hast du geschrieben, dass du mit der Bison-Schutz-Geschichte fertig bist, mit der du gerade so viel zu tun hattest.”
“Wir haben ein paar neue Gesetze durchgesetzt. Die Dinge sind besser geworden. Es wurde Zeit für etwas Neues. Außerdem ist Politik auf Dauer ziemlich demoralisierend.”
“Das verstehe ich nicht. Ihr habt doch gewonnen, oder?”
“Es ging nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es ging um den Schutz der Natur.”
Sie fragte zu viel, und er wollte nicht darauf eingehen. Das war in dieser Familie die übliche Einbahnstraße. Nach den wenigen Telefongesprächen über die Jahre hatte sie sich hinterher jedes Mal ihren Reim machen müssen und war immer wieder enttäuscht gewesen, wenn sie aufgelegt hatte.
Mama June runzelte die Stirn und wandte sich wieder dem Geschirr zu. Sie schwieg für einen Moment, doch als sie die Pfanne abtrocknete, sah sie zu ihm hinüber. Er hatte die Gabel bereits nach wenigen Bissen zur Seite gelegt.
“Zu viel Salz?”, fragte sie betroffen. “Preston sagt immer, ich salze zu viel.”
“Nein, ist in Ordnung.” Er nahm die Gabel wieder in die Hand. “Ich bin oben ein bisschen herumgelaufen”, begann er und drehte versonnen die Gabel in seiner Hand. “Ich war in Hams Zimmer.” Er legte die Gabel wieder ab. “Mir ist aufgefallen, dass Daddys Sachen da drin sind.”
Mama June faltete das Küchenhandtuch sorgfältig zusammen und legte es weg. Morgan sah sie fragend an.
“Ja”, erwiderte sie langsam. “Das ist jetzt sein Zimmer.”
“Seit wann habt ihr getrennte Schlafzimmer?”
“Ich weiß gar nicht mehr, seit wann.” Sie konnte genauso ausweichend sein wie er.
Sie wusste nicht recht, wie viel sie ihrem Sohn erzählen sollte. Er war kein Junge mehr, obwohl er es in ihren Augen immer sein würde. Er war ein erwachsener Mann und kannte sich mit dem Leben aus. Die Probleme zwischen ihr und Preston hatten sich über die Jahre aufgestaut, eine sehr private und persönliche Geschichte zwischen einem Mann und seiner Ehefrau.
Sie gehörte nicht zu den Frauen, die sich mitteilten und gegenüber anderen aussprachen, was sie im Inneren bewegte und berührte. Die Art mancher Frauen, über ihr Privatleben zu plaudern, kam ihr vor, als würde sie durch deren Fenster spähen. Sie dagegen hatte ihre Vorhänge nachts immer zugezogen – welches Zimmer war schließlich intimer als das Schlafzimmer? Sohn oder nicht, das ging Morgan wirklich nichts an.
“Das muss dich nicht weiter wundern. Das ist ab einem gewissen Alter gar nichts Besonderes. Und jetzt nach dem Schlaganfall, wer weiß …” Sie brachte noch ein paar Brötchen an den Tisch.
“Hör auf, mich zu bedienen, Mama June!”
Sie blieb wie angewurzelt stehen und starrte ihn erschrocken an.
Morgan wirkte verlegen. Behutsam zog er einen Stuhl zu sich heran. “Komm her, setz dich, Mama. Du musst hier niemanden bedienen. Bitte.”
Mama June stellte die Brötchen auf den Tisch und ließ sich wortlos auf einen Stuhl sinken.
Morgan legte seine Hand auf ihre Schulter. “Es tut mir leid, dass ich hier einfach so aufgekreuzt bin.”
“Ach, was”, entgegnete sie, fing sich allmählich und machte eine wegwerfende Handbewegung. “Das ist schließlich dein Zuhause. Du bist hier, das ist alles, was für mich zählt. Und es wird deinem Vater unendlich viel bedeuten. Du weiß gar nicht, wie viel.”
Sie sah den Schmerz in seinen Augen aufblitzen, bevor er seine Hand von ihrer Schulter nahm. “Ja, nun …”
“Ganz bestimmt.”
Nach einer Weile sagte er: “Ich sollte ihn besuchen. – Darf man ihn denn überhaupt besuchen?”
Sie hörte aus seinen Worten mehr Pflichtempfinden als herzliche Sorge, und das tat ihr weh.
“Natürlich darf man ihn besuchen”, antwortete sie. “Je öfter, desto besser. Seit zehn Tagen mache ich nichts anderes, als Leute zu beknien, ihn zu besuchen. Ich habe Unmengen von Blumen bekommen und Genesungskarten und mehr Essen, als ich einfrieren kann. Alle waren unglaublich fürsorglich. Trotzdem scheint niemand die Zeit oder den Wunsch zu haben, ins Krankenhaus zu gehen und an seinem Bett zu sitzen. Dabei ist es so wichtig, dass jemand bei ihm ist, verstehst du? Er ist so hilflos. Wie ein Baby.” Sie zögerte. “Du wirst … überrascht sein, wenn du ihn siehst. Ich lasse ihn jedes Mal nur ungern zurück. Man hört so grässliche Geschichten von Fehlern, die sie in Krankenhäusern machen oder was sie in der Krankengeschichte übersehen. Ich fahre jeden Tag in die Stadt und bleibe, solange ich kann, aber es ist einfach nicht genug.”
“Ich werde hingehen.”
Sie tätschelte ihm liebevoll die Hand. “Danke. Es wird ihm so viel bedeuten.”
“Wann wird Daddy denn wieder aus dem Krankenhaus entlassen?”
“Das ist noch nicht entschieden.” Sie zog ihre Hand zurück und ließ sich in ihrem Stuhl zurücksinken. Ihr Blick glitt über den Küchenschrank, und sie betrachtete die aufgeschlagenen Kochbücher und die Einkaufsliste – lauter Vorbereitungen für das Sonntagsessen. Bei aller Freude über Morgans Rückkehr wusste sie, dass es wieder eine hitzige Diskussion geben würde, sobald die Familie zusammenkam.
“Was ist los, Mama June?”
Sie blickte in sein nachdenkliches Gesicht und sah plötzlich wieder den kleinen Jungen vor sich, wie er an diesem Tisch neben ihr saß und gierig seine Cornflakes hinunterschlang. Sie sah, wie er ungeduldig mit den Beinen wippte und die Augen aufs Fenster gerichtet hatte, weil er schon auf dem Sprung nach draußen war. Er war ein sensibles Kind gewesen. Und trotzdem hatte sie mit ihm nie über Dinge gesprochen, die sie plagten, im Unterschied zu ihrer Tochter Nan, mit der sie immer offen geredet hatte.
“Ich bin so verwirrt”, begann sie mit plötzlicher Aufrichtigkeit. “Ich weiß nicht, was ich machen soll.”
Er setzte sich auf, dankbar für ihr Vertrauen.
“Bist du unsicher, wie du ihn pflegen musst? Die Leute im Krankenhaus werden dir schon zeigen, was du machen musst. Und du kannst dir Hilfe holen, wenn er wieder nach Hause kommt.”
“Genau darum geht es. Deine Tante Adele meint, ich soll ihn nicht zurück nach Hause bringen.”
“Oh.” Er machte eine Pause, und sein Blick verdüsterte sich. “Wirklich?”
Zwischen Prestons Schwester Adele und Morgan hatte es seit jeher Spannungen gegeben. Sein Tonfall sagte ihr, dass sich das in den letzten Jahren nicht geändert hatte.
“Adele befürchtet, dass er zu Hause die Pflege, die er braucht, nicht bekommen wird. Sie glaubt, dass wir seine Genesung aufs Spiel setzen, wenn wir ihn nicht dahin bringen, wo er professionelle Betreuung bekommt.”
“In ein Pflegeheim?”, fragte er erschrocken.
“Eher in ein professionelles Altersheim. Die Pflege zu Hause wäre sehr teuer und …” Sie machte eine hilflose Handbewegung. “Wenn sie es mir erklärt, klingt alles so vernünftig. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und ist die Zahlen mit mir durchgegangen. Ich habe nicht mal die Hälfte davon behalten – außer dass ich Sweetgrass verkaufen soll.”
“Sweetgrass verkaufen …” Morgan atmete langsam aus und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. “Wow. Ich würde … ich meine, ich hätte nie gedacht, dass das mal in Betracht kommen könnte.”
“Adele sagt, mit dem Verkauf von Sweetgrass hätte ich genug Geld für Preston und mich, ohne befürchten zu müssen, jemandem zur Last zu fallen.” Sie starrte auf ihre Hände und ließ das Goldarmband an ihrem linken Arm durch ihre Finger gleiten. “Das haben wir nie gewollt, weißt du. Eine Last sein.”
“Ihr seid keine Last.”
“Nein, noch nicht. Aber laut Adele könnten wir das werden. Recht schnell sogar.”
“Adele spricht immer nur von Extremen, das weißt du doch.” Unruhig rieb er sich das Kinn. “Wenn der Schlaganfall Daddy nicht umgebracht hat, dann wird der Verkauf von Sweetgrass das ganz sicher tun.”
“Genau das denke ich doch auch!”, rief sie. Es war eine solche Wohltat, dass endlich jemand ihren Standpunkt verstand. Und dass dieser Jemand ihr Sohn war.
“Was sagen die Ärzte? Kann Daddy überhaupt entlassen werden?”
“Sie finden, dass er nach Hause kann, sofern wir Hilfe bekommen natürlich – also eine Art Armee von Therapeuten und Pflegern mitsamt der dazugehörigen Ausrüstung.” Sie hörte die Hoffnung in ihrer eigenen Stimme.
“Hilfe anheuern wird Geld kosten.”
“Richtig.”
“Und könnt ihr euch das leisten?”
“Für eine Weile. Wahrscheinlich eine sehr kurze Weile.” Mama June seufzte schwer. “Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit dieser Entscheidung so schwer tue. Für Adele ist klar, was ich tun sollte: Sweetgrass verkaufen und wegziehen. Hank und Nan sind einverstanden.”
Morgan dachte einen Moment lang nach und fragte: “Und was willst du tun?”
“Ich muss überlegen, was für Preston das Beste ist.”
“Danach habe ich nicht gefragt. Ich wollte wissen, was du tun willst.”
Sie lehnte sich wieder in ihrem Stuhl zurück. In diesem Augenblick fiel ihr auf, dass in all den Unterhaltungen – mit Adele, Nan und Hank, mit den Ärzten, mit der Bank und dem Anwalt – jeder ihr gesagt hatte, was er oder sie dachten, dass Mama June tun müsse. Aber niemand hatte sie je gefragt, was sie eigentlich tun wollte. Niemand, außer Morgan.
“Um ehrlich zu sein, ich weiß es wirklich nicht. Als dein Vater den Schlaganfall hatte, war ich nicht einmal in der Lage, die alltäglichsten Entscheidungen über Sweetgrass zu treffen. Und nun bin ich plötzlich in der Situation, alle wichtigen Entscheidungen allein treffen zu müssen. Preston wird eine Menge Pflege brauchen, bevor es ihm wieder gut geht – wenn es ihm überhaupt je wieder gut gehen wird. Ich habe versucht zu überlegen, was das Beste für ihn ist, und für uns alle und …”
“Du weichst schon wieder aus”, unterbrach er sie sanft.
“Ach, Morgan, ich bin sechsundsechzig Jahre alt. Ich bin zu alt, um wieder von vorn zu beginnen. Ich lebe seit fast fünfzig Jahren in diesem Haus. Hier bist du aufgewachsen. Dies ist unser Zuhause. Hier waren wir glücklich und …” Sie hob den Blick in der Hoffnung auf gegenseitiges Einverständnis. “All meine Erinnerungen sind hier.”
“Mama, was möchtest du tun?”
Mama June streckte den Arm aus und strich liebevoll über seine Wange. Langsam ließ sie die Hand sinken und sagte leise: “Ich kann die Entscheidung, was ich tun möchte, nicht von dem trennen, was ich für die Familie tun muss. Nach meiner Meinung – und nach der deines Vaters – gehören die Blakelys nach Sweetgrass.”
“Du hörst dich ein bisschen an wie Daddy.” Er kam mit dem Gesicht ein Stückchen näher. “Was möchtest du tun?”, drängte er sie abermals.
Sein Druck erschöpfte sie, und sie stützte ihren Kopf mit der Hand. “Ich weiß es nicht.”
Er beugte sich vor, und dieses Mal küsste er sie auf die Wange. “Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich will dich nicht bedrängen. Ich hätte nur gerne mal zur Abwechslung gehört, was du willst. – Weißt du was? Du bleibst heute zu Hause und denkst in Ruhe über alles nach. Und ich fahre in die Stadt in dieses Krankenhaus und sehe nach Daddy.”
3. KAPITEL
Während der Zeit der Sklaverei im alten Süden stellten die Männer Körbe aus Binsengras her, weil dieses Sumpfgewächs stark war und lange hielt. Die Frauen machten funktionale Körbe für zu Hause und benutzten dafür Sweetgrass, das weicher ist und überall wuchs. Heute werden für die Körbe Sweetgrass, Binsen und lange Nadeln der Sumpfkiefer zusammengebunden und mit den noch ungeöffneten, inneren Blättern der Fächerpalme umwickelt.
Nans Hand lag auf dem Telefonhörer, und sie versuchte, sich zu sammeln.
“Mach den Mund zu, Mama, es zieht.” Harry gab seinem jüngeren Bruder einen Stoß in die Rippen, und beide lachten. Die ganze Familie war am Esstisch zum Abendessen versammelt.
Nan schloss automatisch ihren Mund und begann zu lächeln. Sie beeilte sich, an den Tisch zu kommen.
“Ihr werdet es nicht glauben!”, sagte sie, und ihre Stimme wurde lauter. Die seltene ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer beiden Teenager-Söhne Harry und Chas belohnte sie dafür, ebenso die ihres Mannes Hank.
Ein Blick auf die Bande genügte, um zu wissen, wer der Vater der Jungen war. Nicht dass sie und Harry sich gar nicht ähnlich gesehen hätten. Beide Jungen hatten die blonden Haare und die blauen Augen ihrer Eltern. Der siebzehnjährige Harry war groß und schmal gebaut wie ein Blakely, während Chas kleiner und muskulöser zu werden schien und damit eher nach Hank kam. Aber mit fünfzehn konnte er noch einen Sprung machen und seinen Vater an Größe überrunden.
Hanks kurz geschnittener blonder Schopf tauchte hinter der Post & Courier hervor. “Wir werden was nicht glauben?”
“Das war Mama June. Ihr werdet nicht glauben, wer dort ist!”
“Morgan”, antwortete Hank wenig begeistert und wandte sich wieder seiner Zeitung zu.
Nan war ein bisschen enttäuscht, weil seine schnelle Antwort die Wirkung ihrer Ankündigung hatte verpuffen lassen. Doch sie ließ sich nicht beirren. “Stimmt. Überrascht dich das denn gar nicht?”
“Nicht wirklich. Dein Vater liegt im Krankenhaus. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass er kommt.”
“Was soll daran überhaupt so besonders sein?”, fragte Chas mürrisch, unzufrieden über die Nachricht.
“Genau, wen kümmert’s?”, fügte Harry hinzu. “Wir kennen ihn schließlich kaum.”
Nan runzelte wegen dieser verhaltenen Reaktion verärgert die Stirn und schaltete mit einer schnellen Bewegung den Herd aus. “Na, mich hat es jedenfalls überrascht.”
Manchmal ist es einfach nur hart, mit einer Horde Männer zusammenzuleben, dachte sie. Sie verstanden einfach gar nichts. Familie bedeutete ihnen kaum etwas. Nan war zu Tode gelangweilt von ihren ewigen Sportnachrichten oder den unerträglichen Details über Autos. Hin und wieder kam es ihr so vor, als würde sie das ganze Essen hindurch nur mit sich selber sprechen, während ihr Mann und ihre Kinder ihren verzweifelten Versuch, ein Gespräch zu beginnen, ignorierten und sich stattdessen die Bäuche vollschlugen.
Nan betrachtete ihre Söhne. Mit fünfzehn und siebzehn waren sie gut aussehende Jungen, wie ihr Vater groß und mit klar geschnittenen Gesichtszügen. Aber so gut sie auch aussehen mochten, oft kamen sie ihr irgendwie geistlos vor. Die beiden schienen keine besonderen Interessen oder Ehrgeiz oder Träume zu haben – Eigenschaften, die sogar aus langweilig aussehenden Jungen etwas Besonderes machten. Nan schüttelte unmerklich den Kopf über sich selbst, schob ihre Enttäuschung beiseite und sagte sich, dass das wahrscheinlich nur eine Phase war.
Mit geübten Handgriffen schmeckte sie den Reis ab und füllte ihn in eine bunte Schüssel, die zum Geschirr passte. Sie angelte ein paar Gabeln aus der Schublade und trug den Reis und eine Schüssel mit Butterbohnen zum Tisch, an dem schon ihre Männer warteten. Sie setzte sich, dann beugten sie alle ihre Köpfe und sprachen das Tischgebet.
“Ganz schön traurig, dass ihr euch kein bisschen dafür interessiert, dass euer einziger Onkel in der Stadt ist.” Nan reichte Harry die Reisschüssel.
“Er ist nicht unser einziger Onkel”, korrigierte Harry, griff nach einem Servierlöffel und bediente sich. “Onkel Phillip und Onkel Joe wohnen ganz in der Nähe. Die sehen wir doch andauernd.”
“Von meiner Seite, meinte ich. Bei den Blakelys gibt es nur uns beide, mich und Morgan.”
Hank legte die Zeitung beiseite, um sich Reis aufzutun. “Ich weiß gar nicht, woher du diese plötzliche ‘Wir-beide’-Einstellung hast”, brummte er. “Kommt mir eher so vor, als wäre er der ‘Ich-und-sonst-keiner’-Typ. In all den Jahren, die ich ihn jetzt kenne, hat er immer durchblicken lassen, was er von Familie hält. Wie oft haben wir ihn gesehen? Zwei- oder dreimal? Es liegt an ihm, dass seine Neffen ihn kaum kennen.”
“Ich weiß, ich weiß.” Nan seufzte ergeben und zog die Steaks, die auf einer passenden Servierplatte angerichtet waren, näher zu sich heran. Trotzdem fand sie die Kritik unfair. “Morgan hat seine ganz persönliche Geschichte, vergiss das nicht.”
Ihre Hände an der Fleischplatte, schwieg sie einen Augenblick und sah in die Runde. Momente wie diesen, wenn ihre Familie beieinandersaß, mochte sie ganz besonders. “Dass ich dich und die Jungen habe, ist ein wahres Geschenk”, sagte sie leise und bedachte jeden mit einem liebevollen Blick. “Aber Morgan hat niemanden. Das ist einfach traurig, nichts weiter.”
“Äh, Mama …” Harry hob die Augenbrauen und starrte ungeduldig auf das Fleisch auf der Platte.
“Oh.” Der kostbare Moment war verflogen. Rasch nahm sie Platte und reichte sie herum, dann die Bohnen. Nach und nach füllten sich die Teller mit riesigen Mengen Reis, dicken Scheiben Steak und löffelweise Bohnen.
“Gib mir die Sauce, Chas”, verlangte Harry.
Nan stand auf und stellte die Schüsseln auf das Sideboard. Die Jungen wuchsen schneller als Baumwolle im Juli, und sie schien nie genug zu kochen, um die Fässer ohne Boden zu füllen, die sie ihre Bäuche nannten. Sie seufzte innerlich, während sie zusah, wie sie sich über ihre Teller hermachten. Es kam ihnen gar nicht in den Sinn zu warten, bis ihre Mutter wieder am Tisch saß. Hilfe suchend blickte sie zu Hank, aber der goss gerade Sauce über seinen Reis und hatte keine Augen für die mangelhaften Tischsitten seiner Söhne.
“Jungs …”, murmelte sie, griff nach ihrem Glas und schenkte sich ein großzügiges Glas Wein ein. Als sie sich setzte, sah keiner der drei auch nur auf. Nan nippte an ihrem Wein und schob ihren Teller beiseite.
Wenigstens essen wir gemeinsam, sagte sie sich und kämpfte gegen die Enttäuschung an, die sie beim Essen jedes Mal überkam. Mama June hatte am Esstisch immer lebhafte Diskussionen in Gang gebracht und ihre Kinder ermutigt, sich daran zu beteiligen. Nan konnte sich an erregte Debatten und gemeine Sticheleien erinnern, aber auch an viel Lachen.
Zumindest bis Hamlin gestorben war. Ihr Bruder war so lebhaft gewesen. Der geborene Geschichtenerzähler, immer mit einem Witz auf der Zunge oder einer bissigen Bemerkung im Kopf. Aber alles hatte sich verändert, seitdem er nicht mehr war. Sie trauerte noch immer um ihn.
Als Nan geheiratet hatte, wollte sie diese Lebhaftigkeit in ihrer eigenen Familie wiederbeleben, die ihr nach dem tragischen Tod ihres Bruders, der die Familie auseinandergerissen hatte, verloren gegangen war. Wenigstens hielt sie die Familientradition des gemeinsamen Essens aufrecht.
Da fiel ihr plötzlich etwas ein.
“Ach ja! Mama June hat uns alle für Sonntag zum Essen eingeladen.”