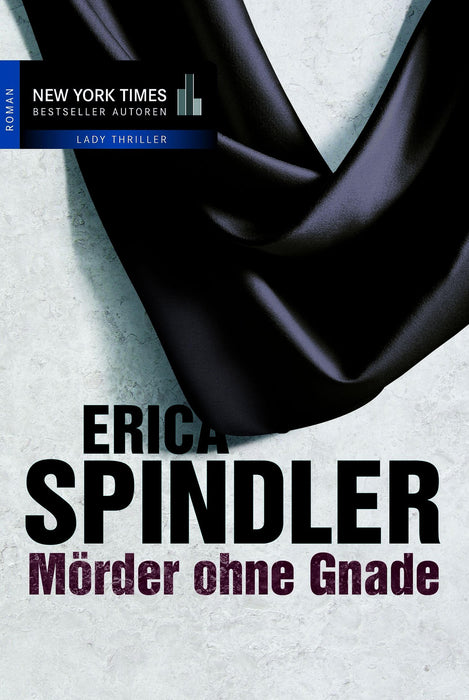
Mörder ohne Gnade
Seit ihrem achten Lebensjahr sind Andie, Raven und Julie beste Freundinnen. Doch im Sommer als sie fünfzehn werden, wird diese Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Heimlich beobachten die Mädchen ein Pärchen beim Extrem-Sex. Kurz danach wird die Frau gefunden - erhängt!
Fünfzehn Jahre später wird Andie, inzwischen erfolgreiche Psychologin, von obszönen Anrufen terrorisiert. Als kurz danach in ihr Haus eingebrochen wird, ahnt sie, dass der Mörder von damals zurückgekehrt ist. In ihrer Angst wendet sie sich an den erfahrenen Polizisten Nick Raphael. Schon bald ist es ihm ein sehr persönliches Anliegen, Andie zu beschützen. Doch kann er einen Mörder aufhalten, der keine Gnade kennt?

