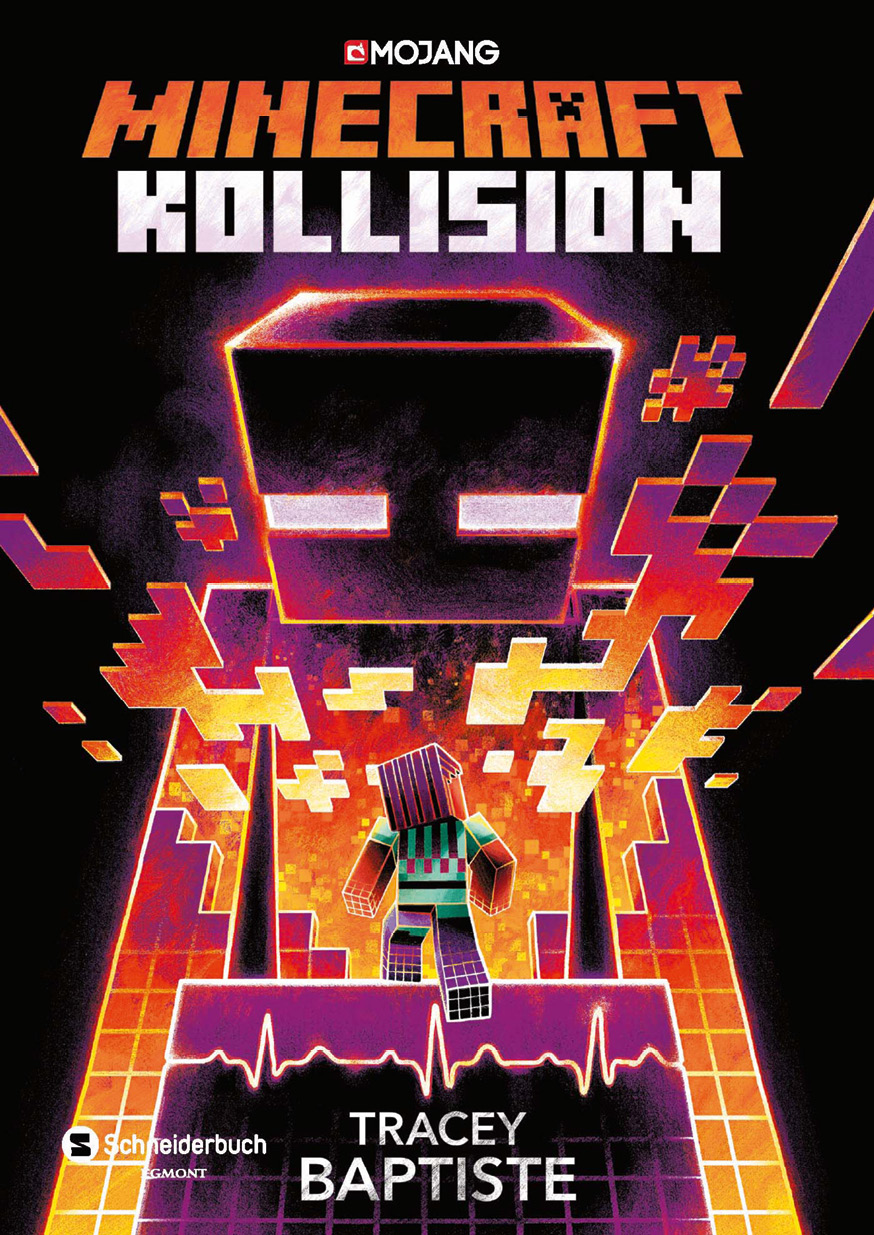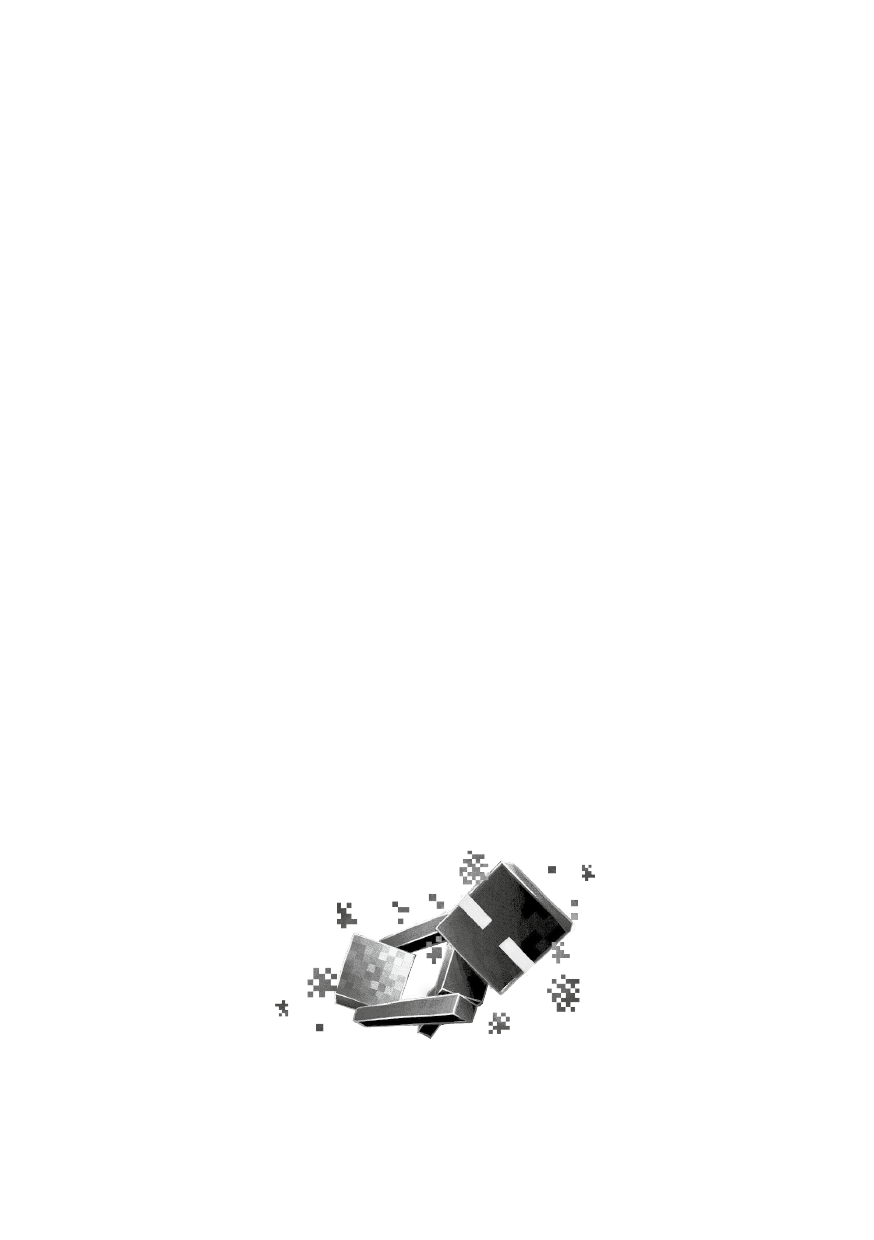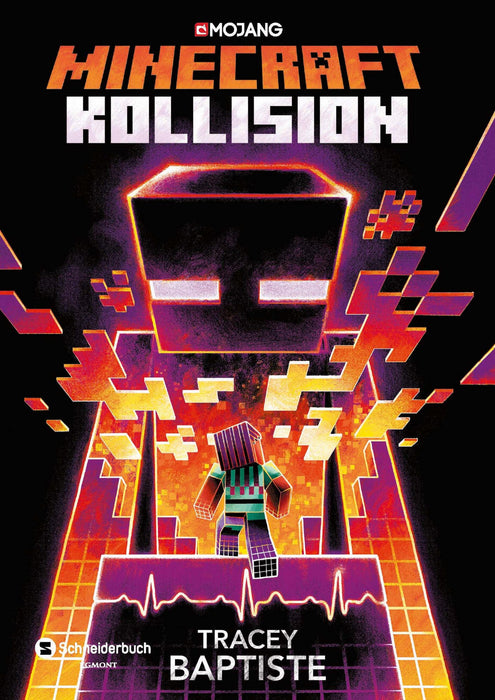
Minecraft - Kollision
Nach einem Autounfall erwacht Bianca schwer verletzt im Krankenhaus. Doch wo ist Lonnie? Von ihrem besten Freund fehlt jede Spur. Ans Bett gefesselt sucht Bianca Ablenkung in einer brandneuen Virtual-Reality-Version von Minecraft. Jeder ihrer Gedanken wird hier Realität, und endlich ist sie wieder Herrin ihrer Welt. Bis Bianca auf einen stummen, scheinbar beschädigten Avatar trifft … Lonnie! Und plötzlich wird es gefährlich - denn im Spiel materialisieren sich nicht nur Biancas Wünsche, sondern auch ihre größten Ängste!
EIN SPANNENDER MINECRAFT-THRILLER!