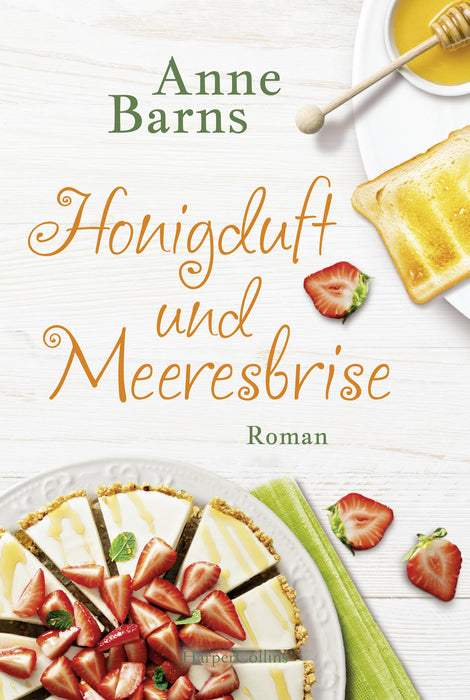
Honigduft und Meeresbrise
»Anne Barns schenkt ihrer Lesergemeinde mit „Honigduft und Meeresbrise“ ein neues mitreißendes, spannungsgeladenes Buch.« Land & Meer
Geliebte Martha, von dir zu lesen, gibt mir unendlich viel Kraft! – So beginnt der Brief, den Anna in Händen hält. Die mit Tinte auf vergilbtem Papier geschriebenen Buchstaben sind noch immer gut sichtbar. Trotzdem fällt es Anna schwer, die geschwungene Schrift zu entziffern. Nur am Datum gibt es keine Zweifel: Dezember 1941. Vor fast achtzig Jahren wurde dieser Brief an ihre Urgroßmutter adressiert, und doch hat Anna ihn eben erst gemeinsam mit ihrer Oma geöffnet. Eigentlich will sie mit ihrem Besuch bei Oma den Verlust ihrer besten Freundin verarbeiten, die bei einem Unfall ums Leben kam. Aber dann führt der Brief Anna schließlich nach Ahrenshoop, wo sie hofft, Antworten zu finden …
- »Anne Barns erzählt von Freundschaft, die Stürme überdauert, und von Geheimnissen, die gelüftet werden müssen, um zurück zu einem erfüllten Leben zu finden.« Nordsee-Zeitung zu »Apfelkuchen am Meer«
- »Gefühlvoll und Mitreißend.« Cellesche Zeitung zu »Drei Schwestern am Meer«

