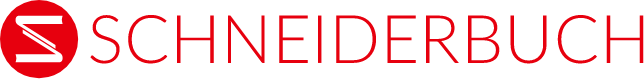Hitler übersetzen
»Hitler zu übersetzen, bedeutet auch, sich gegen seine zeitgenössischen Epigonen zu wappnen.« Olivier Mannoni
»Hitler ist tot, sein Werk des Hasses voll glühender Schwärze ist geblieben.« Es gibt nur wenige Menschen, die so tief in die Abgründe nationalsozialistischer Rhetorik geblickt haben wie Olivier Mannoni.
Zehn Jahre lang übersetzte Mannoni Hitlers »Mein Kampf« für eine kritisch-wissenschaftliche Edition ins Französische. Das Werk, mit dem Hitler seine antisemitischen Thesen und nationalsozialistische Weltanschauung auf über 700 Seiten in eine für den Normalbürger kaum zugängliche Prosa ergoss und sie dennoch »salonfähig« machte. Zwölf Millionen Exemplare waren bis 1945 im Umlauf.
Was macht es mit einem Menschen, sich jahrelang in die Tiefen von Hitlers Sprache zu versenken?
»›Mein Kampf‹ zu übersetzen, bedeutete, ungeahnte Türen zu öffnen. In keinem Text zuvor kam Hass in dieser Dichte und mit solch einer Gewalt zum Ausdruck, dieses von Peter Sloterdijk beschriebene brodelnde, bösartige und verderbliche Ressentiment: eine Art Bank, bei der man − wie bei spekulativen Geldanlagen −, alle Wut und Frustrationen anspart, um sie, sobald der Tag gekommen ist, zu nutzen und den größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen.«
Angesichts einer politischen Realität, in der rechtspopulistische Parteien Regierungen stellen, demagogische Reden ein Revival erleben und nationalsozialistisches Vokabular in unseren Alltag zurückkehrt, warnt uns Olivier Mannoni vor der Wirkmacht sprachlich irreführender Überfrachtungen und dem damit einhergehenden suggestiven Kalkül.
Ein Essay von erschreckender Aktualität.