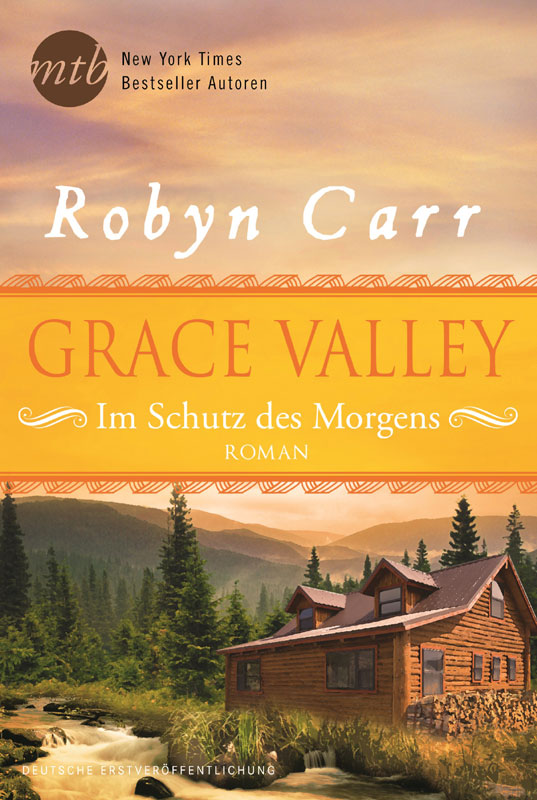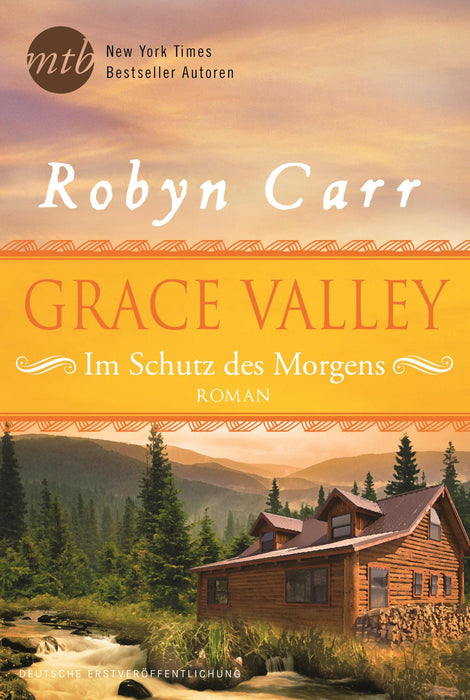
Grace Valley - Im Schutz des Morgens
Grace Valley - Ein Ort zum Träumen!
Tagsüber schließt niemand die Türen ab, auf den Fensterbänken stehen köstlich duftende Kuchen zum Auskühlen und die Bewohner sind wie eine Familie. Das ist es, was June Hudson so an ihrem Heimatstädtchen Grace Valley mag. Und weshalb sie nach ihrem Studium in der Großstadt zurückgekehrt ist, um die Arztpraxis ihres Vaters zu übernehmen. Sie geht mit Herz und Seele in ihrer Arbeit auf und kümmert sich zu jeder Tages- und Nachtzeit um die Menschen im Ort. Platz für Romantik bleibt da nicht. Bis ein gut aussehender Unbekannter ihren Weg kreuzt und sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Doch diese Liebe muss ein Geheimnis bleiben, denn Jim Post muss seine Identität verbergen.