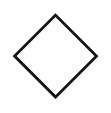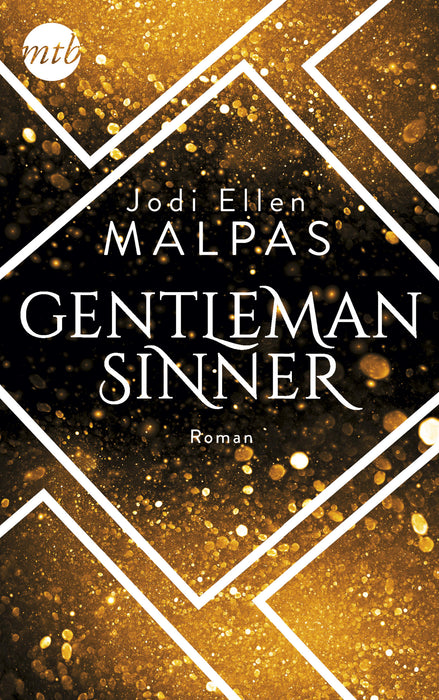
Gentleman Sinner
Izzy White hat bereits früh gelernt, wie erbarmungslos das Leben ist. Aber sie hat nie aufgegeben und ist zufrieden mit dem, was sie erreicht hat. Auf Liebe und Begierde kann sie verzichten – bis das Schicksal sie zu Theo Kane führt. Wie ein dunkler Ritter taucht er plötzlich auf und rettet sie aus einer brenzligen Lage. Er ist groß, muskulös und umgeben von einer düsteren Aura. Nur er lässt sie diese brennende Leidenschaft fühlen, gegen die sie machtlos ist. Doch wenn sie sich diesem Mann hingibt, könnte ihr das zum Verhängnis werden. Denn mit Theo betritt sie erneut die Welt, der sie entflohen ist …
»Malpas‘ heiße Liebesszenen bringen die Seiten zum Glühen, ihre vielschichtigen, verletzlichen Charaktere erobern mit Leichtigkeit die Leserherzen.«
Publishers Weekly
»Theo ist unwiderstehlich.«
Booklist
»Jedem Kuss, jeder erotischen Szene, jedem Wortwechsel zwischen diesem Paar gehört ein Stück meiner Seele.«
SPIEGEL-Bestsellerautorin Audrey Carlan über »Mit allem, was ich habe«