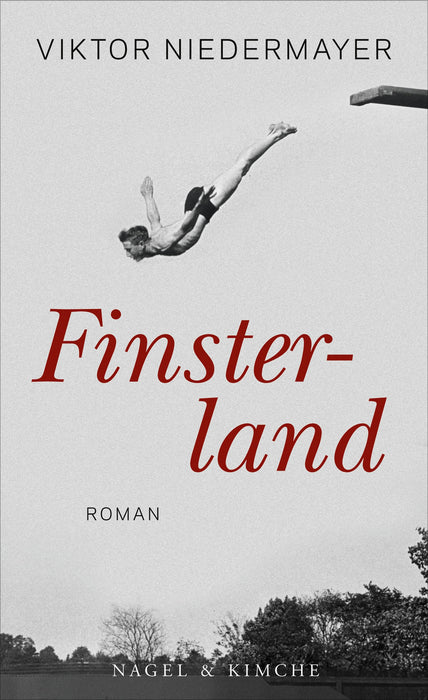
1
Ewig geht die Litanei dahin. Die Wachsstöckerl flackern, Schatten huschen oben auf dem Gang. Aus den Wolken in der Kuppel kommen Blitze, der Regenbogen biegt sich über der Arche Noah, der Busch brennt, und Gottvater redet auf den alten Mann ein, dass er das Kind ersticht. Auf der anderen Seite stürzt der schwarze Luzifer mit den Fledermausflügeln vom Himmel herab, hinunter zu den armen Seelen im Fegefeuer. Die einen sind bis zur Brust, die andern nur noch bis zum Bauch in den Flammen. Sie winden sich in ewigem Schmerz und werden von Ratten, Nattern und Höllenhunden angefallen.
Von der Decke schauen fette Buberl mit Flügeln zu mir herunter; die heiligen Bischöfe verdrehen ihre Augen und deuten auf die Heilige Schrift. In ihrem goldenen Buch sind alle meine Sünden aufgeschrieben für das Jüngste Gericht. «Dann stehst du», sagt die Mutter, «vor deinem obersten Richter.» Der sitzt auf seinem Thron über den Wolken, die Gräber bersten, und alle werden wieder lebendig, steigen heraus und sehen so jung aus, wie sie einmal waren. Darauf müssen sie zu ihm hin und ihn lobpreisen bis in alle Ewigkeit. Die Ewigkeit aber hört nimmer auf. «Alle tausend Jahre», sagt die Mutter, «kommt ein Vogerl, wetzt einmal seinen Schnabel am höchsten Berg der Welt, und wenn der abgetragen ist, ist erst eine Sekunde der Ewigkeit vorbei.»
Aus den Bänken kommt ein Husten, ein Räuspern, ein Schneuzen. Es riecht nach alten Leuten, Mottenkugeln und Weihrauch. Und wieder schlägt die Glocke ein paar Mal mit hellem Klang. Langsam ziehen die Pater durch den Gang, beten und singen. Im Schein ihrer Kerzen flackern die Totenköpfe und die silbernen Knochenmänner in den Seitenaltären. Dann steigen sie hinunter in die Gruft, wo die Leichname eingemauert sind. Wenn wir aus der Kirche kommen, ist es schon dunkel. Der Heimweg ist lang. Die Schuhe sind immer zu klein, immer nass vom Schneewasser und eiskalt.
Die Marielle hat auf dem Nachtkastl ihren eigenen Altar aufgebaut. Die heilige Maria aus dem Versandhaus Witt in Weiden ist in einen weiten, blauen Umhang gehüllt; in ihrem roten Herzen steckt das Schwert so tief, dass das Blut heruntertropft. An der Krone ist die Scheibe vom Heiligenschein angeleimt. Wie alle Heiligen schaut sie zur Decke hinauf, als ob dort schon der Himmel wäre. Neben ihr stehen zwei Hummel-Engel und halten Kerzerl in den ausgestreckten Armen. Das gelbe Stramindeckerl hat die Marielle in der Handarbeit bei der Mater Xaveria gestickt.
Jeden Abend kniet sie mit der Mutter vor ihrem Altar. Die Mutter betet vor: «Du Turm Davids, du elfenbeinerner Turm, du Mutter der Weisheit, du göttliche Gnadenmutter …» Nach jedem Anruf antwortet die Marielle: «Bitt für uns, bitt für uns …» Dann singen sie: «Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn; in Freuden und Leiden, ihr Diener ich bin; mein Herz, o Maria, schlägt ewig zu dir …» Bevor die Mutter geht, taucht sie ihren Finger in das Schüsserl mit dem feisten Engerl und spritzt uns das kalte Weihwasser ins Gesicht. Sobald sie das Licht gelöscht hat, wische ich es wieder ab. Auch wenn ich dafür ins Fegefeuer komme, habe ich keine Angst. Ich werde ewig leben und niemals sterben.
Neben meinem Bett hängt das Plakat mit dem Hitler. Darauf sind tausend kleine Köpfe, die alle zu ihm hinaufschauen. Er steht ganz groß in der Mitte. Die eine Hand hat er am Koppelschloss, die andere, zum Hitlergruß erhoben, ist so weit nach hinten gebogen, dass man keine Finger mehr sieht. Einen Hitler ohne Finger, den muss ich immer wieder anschauen, davon kann ich nicht genug kriegen. Das Plakat hat mir ein SA-Mann geschenkt. Ich will wissen, was droben steht, und er liest mir vor: «Führer befiehl, wir folgen dir.» Am Abend steigt der Vater auf unseren Schemel und heftet das Plakat mit Reißnägeln an die Tür. Jetzt schaut mein Hitler mit seinem schwarzen Barterl Tag und Nacht hinüber zur Marielle ihrer Mutter Gottes.
Die Marielle hat im Zeugnis lauter Einser. Unten steht mit schöner Klosterfrauenschrift: «Nur weiter so, Marielle!» Zu meiner Mutter sagt die Mater Agnes: «Sie ist meine Musterschülerin.» Nicht ein einziges Mal schreibt sie in ihrem Schönschreibheft über die Zeilen hinaus, kein einziger Tintenbatzen ist darin. «Und schauen Sie nur», sagt die Mater Agnes, «sie will alles so genau und gut machen, dass ihre Schrift ganz zittrig ist.» Die Mutter seufzt: «Wenn nur der Bub auch so wäre.» Das Kind war schon immer wie vom Teufel besessen. Kaum trägt es die Hebamme in die Kirche, fängt es an zu schreien wie am Spieß, und als ihm Hochwürden das Weihwasser auf die Stirn träufelt, schreit es noch lauter und schreit und schreit, bis die Kirchentür hinter ihm zufällt. Dann tut es einen tiefen Seufzer und macht von da an keinen Muckser mehr.
Vom Kinderwagl aus langt das Kind hinüber zur heiligen Familie in der Krippe, holt sich erst die Muttergottes heraus, dann den heiligen Josef und nagt ihnen mit den ersten beiden Milchzähnen den Gipskopf bis zum Drahtgerippe ab. Warum keine Hirten, keine Schaferl, die alle ganz vorn standen? Nein, die Mutter Gottes und der Nähr- und Pflegevater des Heilands müssen es sein.
Seit die Marielle beim Kindheits-Jesu-Verein ist, muss sie beim Essen immer überlegen, ob sie weiter essen darf oder ein Opfer bringen soll. Wenn ihr vor dem Lebertran graust, presst sie die Augen zusammen und flüstert: «Alles für dich, heiligstes Herz Jesu.» Wenn sie neben dem Klavierlehrer Heinze sitzen muss, der ganz braune Finger hat vom Zigarettenrauchen, tut sie es nur für das liebe Jesuskind. Die Osterhasen, Sarotti-Mohren und den Schokoladennikolaus hebt sie so lange auf, bis sie weiß vom Schimmel sind. Die Fünferl, die sie fürs Radlputzen kriegt, wirft sie dem Negerbuberl in der St.-Joseph-Kirche durch den Schlitz im Kopf. Dann nickt es ein paar Mal, und der Missionar in Afrika kann wieder ein neues Heidenkind bekehren.
Zu jeder Hausaufgabe macht die Marielle eine Fleißaufgabe. Dafür bekommt sie von der Mater Agnes ein Hauchbilderl mit der heiligen Mutter Gottes. Den einen Fuß setzt die heilige Maria auf die Weltkugel, den andern auf den Kopf der Schlange. Wenn man das Bild anhaucht, wölbt sie sich nach oben und sieht aus wie lebendig. Über einer brennenden Kerze macht sie sogar einen Bauchtanz.
Die Freundinnen der Marielle haben echte Seidenstrümpfe und dünne Seidenkleider an, Goldketterl um den Hals, goldene Ohrringerl und rote Schleiferl im Haar. Sie bringen Katzenzungen in der Pralinenschachtel mit und tauschen Zigarettenbilder aus – die Anny Ondra gegen die Pola Negri, den Willy Fritsch gegen den Harry Piel. Jedes Mal wollen sie meine langen Wimpern und weißen Zähne sehen, und ich muss die Augen zumachen und die Mundwinkel auseinanderziehen. Die Silber Elvira wohnt am Unteren Tor, wo ihre Mutter alles am billigsten verkauft. Die Sommer Ruth vom Pianohaus Sommer & Sommer ist schon im Stadttheater aufgetreten. Die Ofenloch Martha steppt mit ihren schwarzen Spangenlackschuhen wie die Shirley Temple im Kino und singt dazu: «… und wer nicht mittanzt, hat Stroh im Kopf, honey, pony, didl didl doo …»
Im Wartezimmer von Marthas Vater riecht es stark nach Chloroform; der Kastanienbaum vor dem Fenster sieht jedes Mal anders aus. Einmal hat er weiße Kerzen, einmal gelbe Blätter oder Schneepolster auf den schwarzen Ästen. Im Sommer kommt die warme Luft durch den Fensterspalt, und man hört die Vögel singen und die Kinder schreien. Im Winter riecht es nach den nassen Mänteln an den Kleiderhaken. Hinter der Tür summt der Bohrer, Instrumente fallen auf die Glasplatte. Der Herr Doktor Ofenloch redet, und hin und wieder lacht das Fräulein, das neben ihm steht. «Er kann kein Blut sehen», sagt meine Mutter, «darum ist er Zahnarzt geworden.» Noch nie hat er mir beim Bohren wehgetan; doch schon am nächsten Tag fallen seine Plomben wieder heraus. Dann schmeckt mein Mund nach Chloroform, und meine Zunge spürt die scharfe Kante vom herausgebohrten Loch.
Jetzt ist die Praxis vom Doktor Ofenloch geschlossen. Die ganze Familie ist weggezogen. Auch die Silber Elvira, die Schwarzhaupt Miranda und die Sallinger Esther kommen nicht mehr zur Marielle. Die Modegeschäfte ihrer Eltern sind mit Brettern vernagelt. Aus dem Pianohaus Sommer & Sommer tragen SA-Männer die Klaviere heraus.
Die neuen Freundinnen von der Marielle sind alle beim BDM, beim Bund Deutscher Mädel. Beim Marschieren hüpfen die Bomperl an ihren Kniestrümpfen mit dem Zöpferlmuster auf und ab, und die Ledereicheln an den Haferlschuhen nicken im Takt. Beim Sprechchor schreien sie so laut, dass ihre Köpfe rot werden: «… und wer nicht kämpfen will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht.» In der Freizeit sammeln sie Altmaterial und stricken Socken für die Soldaten. Auf der Straße halten sie Ausschau nach Spionen, Miesmachern, Hamsterern und Drückebergern. Im Winter riechen sie nach Mottenkugeln, im Sommer nach Schnittlauch und rohen Zwiebeln. Bei der Morgenfeier im Stadttheater sehe ich ihre abgebissenen Fingernägel, die Schrunden am Ellbogen und die Schuppen auf der braunen Kletterweste. Die Förster Trudi zeigt extra ihre Silberkrone am Schneidezahn her. Die Amstetter Burgl ist Vegetarierin geworden wie der Führer. Sie hat schon rote Backen.
Die Marielle reißt die Tür auf, feuert das «Lob Gottes» auf die Kredenz und rennt zum Drahtfunk. Vom Reichssender München kommt das «Schatzkästlein». Und schon hauen sie wieder auf die Tasten und kratzen auf den Cellos und Bratschen herum. Händel, Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven. Die Marielle macht die Augen zu, auf ihrer Stirn ist eine steile Falte. Jetzt darf ich nicht mehr weiter sägen. Mit künstlicher Stimme sagen sie Verse auf von Eichendorff und Hölderlin, Goethe und Schiller. Beim Hans Carossa knirscht der Kiesweg in der Nacht, um den Hans Watzlik auf seiner Burg im Bayerischen Wald rauscht der Tann, beim Georg Britting poltert’s aus der Kegelbahn, murrt das Gewitter, und schon wieder steht der Hecht in der blauen Donau. Und so geht’s dahin: die Gedichte der Droste-Hülshoff, der Agnes Miegel, die Geschichten vom Freiherrn von Münchhausen und vom Doktor Owlglass, und der Weinheber hat wieder eine neue Ode an den Führer gedichtet. Schon lange, bevor die Stelle beim Claudius kommt, schreie ich: «… und unsern kranken Nachbarn auch!» Beim Walther von der Vogelweide spitze ich den Mund: «Verloren ist das Slüsselin!» Endlich öffnet die Marielle die Augen. Sie springt auf: «Du Rüpel!» Doch ihr Fußtritt geht ins Leere. Mit dem Wasser in den Augen kann sie nicht so genau zielen.
2
Mit jedem Schritt sinke ich tiefer ein, schon reicht mir das warme Wasser über die Knöchel. Aus dem Boden gluckst es, ringsum rascheln die Halme. Dick und breit, wie im Schlaf, sitzen die Kröten im Sumpf. Ihre Drachenhaut ist schrundig, ihre Hände und Finger sind so winzig, dass mich der Schauder durchfährt, in ihren großen Augen spiegelt sich mein Gesicht. Ein nächster Schritt – und dort, wo sie gerade noch waren, ist nur noch eine Wolke aus Schlamm.
Um den Schuppen wuchern mannshohe Brennnesselfelder; ihre dicken Blätter haben einen satten blauen Schimmer. Rostige Öfen, Tiegel, Pfannen und Herdplatten liegen im Gras, Waagscheite und zerbrochene Wagenräder. Der Hanomag ist ohne Fensterscheiben, die Räder sind in den Boden gesunken, und durch das verrostete Blechdach wächst ein kleiner Baum. Hummeln brummen an meinem Ohr, weit oben jagen die jungen Schwalben durch die Luft.
Im Sommerhaus unter den alten Föhren hat der Wind die Nadeln auf dem Boden zum Kreis gekehrt; das geflochtene Fenstergitter wirft ein helles Strahlenmuster auf die Bretter. Am Wehr stehen im feinen Tropfenstaub die Libellen – und sind schon wieder fort. Wie eine flüssige, schwarze Wand stürzt der Bach in die Tiefe. Ein Schwall nach dem andern sinkt in den Abgrund, und wenn ich lange genug hinschaue, hört das Fließen plötzlich auf und das Tosen verstummt. Tonlos und starr steht das Wasser da. Doch jetzt beginnen die Bäume am Ufer zu kreisen, immer schneller und schneller. Brausend wirbeln sie um mich herum, wollen mich in den Strudel mitreißen. Im letzten Augenblick pack ich mit beiden Händen den Zaun und warte, bis alles ist wie zuvor.
Die Steinplatten im Hausflur sind eiskalt; sie stechen durch meine nackten Fußsohlen bis in den Kopf hinauf. Auf der Treppe muss ich alle knarzenden Stufen auslassen, weil sie sonst ein Unglück bringen. Im Wohnzimmer sitzt der Großvater auf seinem Lederkanapee, vor ihm der Hund, das Kinn auf die Pfote gelegt. Seine Ohren bewegen sich, und wenn er glaubt, ein Wort klinge so, als könnte es für ihn sein, blinzelt er ein wenig.
Der Großvater ist der erste Mann, der mit mir redet. Ich darf ihm alles sagen, was mir in den Sinn kommt, und noch nie hat er mich geschimpft. Sogar um den Hals darf ich ihn fassen, und wenn ich seine Hand über mir sehe, zucke ich nicht zusammen und blinzle aus Angst vor dem Schlag. So wie ihn stelle ich mir den lieben Gott vor.
Im Bücherschrank stehen die beiden dicken Bände: «Unsere Bayern im Felde». Darin ist das Bild vom Kronprinzen Luitpold von Bayern, der vor seinem Garderegiment dem Feind entgegenreitet, und das Bild mit den bayerischen Pionieren in ihren Unterständen in Flandern. Grell vom Vollmond beleuchtet, patrouilliert unser Reiterregiment Siebzehn am Isonzo. Auf der nächsten Seite überholen die Chevaulegers im Galopp die sechsspännigen Geschütze der Schweren Artillerie, die im Morast steckengeblieben ist. Von den blutrot brennenden Ölfeldern in Rumänien zieht der Rauch in schwarzen Schwaden davon, und ganz vorne stehen die bayerischen Kanoniere. Die Spitzen auf ihren Stahlhelmen sind schwarz gezackt wie in einem Scherenschnitt.
Immer wieder muss mir der Großvater die Geschichte vom bayerischen König erzählen. Der Diener trägt die silberne Schüssel, mit Erbsen und Linsen gefüllt, in sein Gemach. Der König legt die Linsen in die eine Schale und die Erbsen in eine andere. Dann läutet er dem Diener, der trägt beide Schalen hinaus, mischt die Erbsen wieder mit den Linsen und bringt sie in der silbernen Schüssel zum König zurück.
Im Winter staut der Großvater den Bach im Franzosengraben. Sobald er zugefroren ist, schaben die Männer das bucklige Eis glatt und schlagen die Kerben zum Eisstockschießen. Ich fahr mit den Schlittschuhen bis hinauf zum See, wo das Eis schon ganz dünn wird. Immer mehr Wasser quillt herauf, der wässrige Bug vor meinen Schlittschuhen wölbt sich immer höher, weit weg schon das helle Krachen der Eisstöcke. Erst wenn der bleigraue Himmel schon schwarz wird und das Schneetreiben so dicht, dass ich das Ufer nicht mehr sehe, kehre ich um. Beim Heimgehen brennen die Straßenlichter; zäh fließt der Donaunebel in ihrem Schein vorbei.
Im Sommer stehen die Korn-Mandln in langen Reihen auf den Feldern des Großvaters. Ein Fuhrwerk nach dem andern schwankt hoch beladen in den Hof herein. Die Pferde rutschen auf dem Pflaster, ihre Hufeisen schlagen Funken. Die Knechte heben die Garben zu den Mägden auf dem Dreschwagen hinauf. Die Körner schießen in die Säcke. Die Kolben der Dampfmaschine sausen, über dem Kamin zittert die Luft. Der Treibriemen schwingt auf und ab. In der Luft liegt der Geruch von heißem Öl und frischem Stroh. Rot versinkt die Abendsonne hinter der Staubwolke.
Im Herbst laufe ich dem Großvater über die gemähten Felder entgegen. Die nackten Fußsohlen schiebe ich flach über den Boden, dass mich die Stoppeln nicht stechen. Sein Arm liegt auf dem Lauf der umgehängten Flinte, am Gürtel baumeln die Fasanen. Der Hund zieht an der Leine, weit hängt die Zunge aus dem Maul. In der Küche darf ich die Vögel von den Lederschlaufen lösen und der Magd zum Rupfen bringen. Einmal liegt, lang ausgestreckt, ein großer Hase auf dem Küchenboden. Sein Auge schaut mich so fest an, dass es lange dauert, bis ich mich getraue, sein weiches Fell zu streicheln.
«Heute ist wieder Fackelzug», sagt die Großmutter und macht das Fenster zu. Unten geht der Biwonka über den Hof. Bis jetzt habe ich den böhmischen Melker nur im Stallgewand gesehen, an den Füßen die holzgeschnitzten Böhmschuhe. Wenn die Magd etwas von ihm wollte, schob er seinen Karren einfach weiter. Sie musste ihm nachlaufen und dreimal fragen, bis er etwas sagte. Jetzt hat er eine braune Uniform und Stiefel an, und auf dem Kopf sitzt eine Mütze mit einem tiefen Einschnitt in der Mitte.
In der Nacht reißt mich ein Donnern aus dem Schlaf, stärker als beim schlimmsten Gewitter. Pauken und Trompeten, Trommeln und Fanfaren, Brüllen und Schreien. Das Echo schlägt von den Häusern zurück. Ich spüre die Gewalt im Magen, sehe das Feuer lodern, noch bevor ich die Augen öffne. Die Wände zittern, das Zimmer brennt. Das muss das Jüngste Gericht sein, von dem mir die Mutter immer erzählt. Oder der Antichrist mit seinem Teufelswerk. Ein Meer von Fackeln erfüllt die Straße, die Schatten der Marschierenden tanzen an den Hauswänden auf und ab. Die Männer haben den Sturmriemen fest um das Kinn geschnallt und singen: «Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, SA marschiert, in ruhig festem Tritt …» Und wieder schwenkt eine neue Kapelle ums Haus, singt eine neue Abteilung: «Unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann, und die Fahne führt uns in die Ewigkeit, ja, die Fahne ist mehr als der Tod.»
Erst nach langer Zeit hört der Lärm auf; allmählich wird es wieder dunkel. Die grauhaarigen Männer, die jetzt noch kommen, haben die Fackeln gelöscht und lassen sie wie Regenschirme hängen. Sie reden miteinander, lachen und husten; dunkelrot glimmen ihre Zigaretten zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Mutter schließt das Fenster, seufzt, deckt mich zu und spritzt mir das Weihwasser ins Gesicht. In den Schlaf hinein knarzen die Stiefel des Vaters draußen im Gang.
Bald darauf ebnen die Männer vom Arbeitsdienst die Kornfelder ein und machen die Landebahn für den neuen Flughafen daraus. Das Fundament für die Halle ist zweimal so groß wie unsere Stiftskirche. Im Pferdestall des Großvaters liegen Stahlplatten und Eisenrohre; aus dem Halbdunkel sprühen die Funken. Im Kuhstall nageln die Schreiner Tische und Spinde zusammen. Soldaten laden die fertigen Möbel auf das Lastauto und bringen sie in die neue Artilleriekaserne. Von früh bis spät fahren Pferdefuhrwerke, mit Erde, Sand und Schotter beladen, durch den Hof. Die Tauben und die Hühner sind verschwunden. Brackwasser steht in den tiefen Fahrrillen; Unkraut sprießt aus den zerbrochenen Steinplatten. Dann wird auch der Bach zugeschüttet und der Froschweiher aufgefüllt. Der Heustadel ist abgebrannt. Zuletzt sägen die Männer vom Arbeitsdienst die Allee zum Haus ab; kreuz und quer liegen die Kastanienbäume am Boden. Wenn der Biwonka etwas sagt, fangen die Männer zu rennen an. Er ist Arbeitsdienstführer geworden.
Am Haus vom Großvater hängt jetzt ein Vorhängeschloss. Die Fenster sind eingeworfen, Spinnweben wehen im Wind. Die Beete im Garten sind zertrampelt; wo die Rhabarberblätter hoch und grün wie in einem Märchenwald standen, ist nur noch zerwühlte Erde. Überall Schilder: «Betreten verboten!», «Fotografieren verboten!» Über meinem Kopf schweben die Doppeldecker zur Landung herein. Fast streifen sie die Wetterfahne auf dem Haus. Plötzlich eine Stimme: «Hau ab, du Rotzlöffel, sonst knallt’s!» Der Posten hinter dem Zaun reißt sein Gewehr herunter und hält den Lauf auf mich gerichtet.
3
Die Betti ist jünger als ich und so klein, dass sie noch immer aufrecht unter dem Briefkasten stehen kann. Doch beim Davonlaufen holt sie mich leicht ein, und auch auf unsern Baum klettert sie so flink wie ich. Ich muss mich nur an den Stamm lehnen, die Hände zu einem Tritt verschränken, und schon hat sie einen Fuß auf meine Schulter gesetzt, packt den Ast über ihrem Kopf und ist zwischen den Blättern verschwunden. Jedes Mal warte ich darauf, dass ihr weißes Kleiderl mein Gesicht streift und ich ihren warmen Körper spüre.
Oben, wo die Äste ganz dünn werden, schaukeln wir, bis sich der Stamm biegt. Wir rütteln und schütteln den Baum, die Zweige schlagen gegeneinander und schnellen zurück ins Gesicht. Über uns fliegen die Wolken dahin, unter uns rieseln die dürren Blätter zu Boden. Unser Schiff fährt auf dem Meer dahin, und der Sturm wirft es von einer Seite auf die andere. Immer wilder werden die Wogen, immer schlimmer tobt der Orkan. Mit beiden Händen klammern wir uns an den Mast, eng stehen wir nebeneinander. Die Häuser an der Leistnerstraße sind Schiffe und die Türme in der Stadt die Wolkenkratzer von Amerika.
Beim Fliegerfahren packe ich die Betti am Hand- und am Fußgelenk und drehe mich so schnell im Kreis, bis sie waagrecht in der Luft liegt wie die schwebende Fee im Zirkus. Beim Berg- und Talfahren ist ihr Gesicht bald hoch über mir, bald streift es beinahe den Boden. Einmal reißt mich der Schwung über den Randstein hinunter und weiter, mitten auf die Straße. Schon höre ich Bettis Kopf auf das Pflaster krachen und sehe sie tot am Boden liegen. Da schießt eine Kraft in mich hinein, wie ich sie noch nie gespürt habe. Knapp über dem Asphalt fange ich sie wieder auf, eine Drehung, eine zweite, und die Betti fliegt wieder wie vorher um mich herum. Danach lacht sie, als wäre alles nur ein Spaß gewesen.
Die Betti hat vor niemandem Angst; nicht einmal vor den SA-Männern. Sie wartet, bis sie ganz nah sind. Dann zeigt sie ihnen ihre feuerrote Zunge. Die Farbe kommt vom Hakenkreuz-Zeltl; es hat einen roten Mantel um das schwarze Hakenkreuz und kostet nur zwei Pfennig. Der SA-Mann will sie packen, doch die Betti hat sich schon weggeduckt. Wir laufen davon, um das Haus herum, hinein in den Hof und springen die Stufen hinunter zum Mehlkeller. Ganz still und eng beieinander sitzen wir in der Dunkelheit vom Schacht, halten uns an der Hand und warten, bis das Herzklopfen vergeht. Nie mehr habe ich mich so glücklich gefühlt. Nie mehr habe ich dorthin zurückgefunden.
Sobald die Betti in die Nähe ihrer Mutter kommt, packt sie die Frau Abel und busselt sie ab. Meine Mutter hat das noch nie mit mir gemacht. Meine Mutter probiert die Sauce mit dem Kochlöffel, die Frau Abel mit dem Finger. Meine Mutter walkt den Teig mit dem Nudelholz aus, die Frau Abel zieht ihn mit den Händen aus. Meine Mutter kann nur den trockenen Strudel mit der braunen Kruste. Bettis Mutter macht auch den saftigen Rahmstrudel mit den vielen Rosinen und nimmt zweimal so viel Schmalz her. Beim Kochen singt sie das Lied von Theo Reuter mit den vielen Strophen. Alle beginnen mit «einmal im Jahr …» und hören mit «rechts steht der Eduard und links die Grete …» auf.
Die Frau Abel gibt der Betti alles, was sie zum Spielen will, sogar die schöne Tischdecke für unser Zelt im Hof. In ihrem Wohnzimmer dürfen wir alles in die Hand nehmen, was im Glaskasten steht. Da sind die kleinen Tassen mit dem Goldrand, die Teepuppen mit dem silbernen Engelshaar und den weiten Spitzenröcken, die fein verzierten Glasvasen und die zwei roten Dackel mit den Löchern auf dem Kopf zum Salz- und Pfefferstreuen. Halten wir die große Muschel fest ans Ohr, hören wir das Meer rauschen. Das Hochzeitsbild im Silberrahmen hat ein eigenes Fach, und darüber sind die goldgefassten Parfumfläschchen mit den Quasten und dem roten Gummiball. Ganz oben steht die Marmoruhr mit den gläsernen Hirschen. Jede Stunde drehen sie sich einmal im Kreis, und dazu klingen die feinen, durchsichtigen Zapfen wie helle Glöckchen.
Hinten im Gang wohnen die Großeltern von der Betti. Sie reden jiddisch mit ihr, und sie redet bayerisch mit ihnen. Wenn sie Sabbat haben, zünden sie den siebenarmigen Leuchter an und gehen in die Synagoge an der Wittelsbacher Straße. Der Großvater hat sein schwarzes, rundes Kapperl aufgesetzt; die Großmutter die goldenen Ohrringe und das dunkle, glänzende Gewand an, das von der Brust gerade bis zum Boden fällt. Das Beten in der Synagoge hört man bis auf die Straße hinaus. Es klingt, als rausche der Kies vom Fuhrwerk hinunter.
Der Vater von der Betti ist der Ingenieur vom städtischen Wasserwerk. «Wir haben das beste Trinkwasser von ganz Deutschland», sagt er. Es fließt unterirdisch aus dem Gebirge zu uns her, durch Kies und Sand, und wenn es nach ein paar Jahren im Wasserwerk ankommt, ist es immer noch eiskalt. In der Frühe höre ich ihn aus dem Badfenster singen: «… ich hab mich ergeben, mit Herz und mit Hand, dir Land vor Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland.» Auf seinem Pullover sind die vier F vom Turnverein eingestickt: «Frisch-Fromm-Fröhlich-Frei»; die Hosenbeine seiner Breeches-Hose hat er in die Kniestrümpfe gesteckt. Er ist der einzige Mann in der ganzen Stadt, der noch ein Rad mit den alten Holzfelgen, eine starre Nabe und eine Karbidlampe hat. Bevor er aufsteigt, richtet er sich das Pedal, setzt den linken Fuß auf den Sporn am Hinterrad und schiebt ein paar Mal an. Es dauert lange, bis er den andern Fuß über den Sattel bringt. Das Rad fängt an zu zuckeln, doch kurz bevor es umfällt, findet sein rechter Fuß den Halt – und schon saust der Herr Abel die Leistnerstraße hinunter.
In aller Früh wartet der Herr Erndl mit seinem Mietauto vor dem Torbogen. Die Koffer hat er bereits heruntergetragen und mit den Lederriemen auf den Gepäckträger geschnallt. Immer wieder schaut er auf die Uhr. Dann kommen endlich Bettis Großeltern die Treppe herunter. Zuerst hilft der Herr Erndl der Großmutter ins Auto, dann dem Großvater. Die Betti und ich schauen zu, wie lange sie brauchen, bis er endlich die Türen zumachen kann. Sie fahren, sagt die Betti, mit dem Orientexpress nach Frankreich. Bald besucht die Betti sie dort, und wenn ich will, kann ich mitkommen.
Früher hat die Frau Holmer am Waschtag mit der Familie Abel gegessen. Dann ist sie mittags lieber in der Waschküche geblieben, und die Betti hat ihr das Essen hinuntergetragen. Jetzt kommt sie gar nicht mehr. Auch die Edith hat ihre Stelle gekündigt. Nun muss die Frau Abel das Geschirr selber abspülen und die Teppiche im Hof ausklopfen.
Schon lange singt die Frau Abel beim Kochen nicht mehr. Wenn sie bei meiner Mutter in der Küche sitzt, hat sie feuchte Augen und rührt beim Reden im Kaffee herum. «Mein Mann kommt erst nach Hause, wenn es schon dunkel ist. Und was ich ihm auch hinstelle, nichts rührt er mehr an.» Bevor sie aus der Wohnung geht, horcht sie an der Tür, ob die SS-Männer noch immer im Gang auf den Herrn Schobert warten. Der ist jetzt beim Schwarzen Korps. Mit seinem neuen Zwicker und dem Bartl sieht er aus wie der Himmler. Auf seiner Mütze hat er den silbernen Totenkopf und am Kragen die gekreuzten Knochen. So eine Uniform möchte ich auch einmal haben, wenn ich groß bin.
Bei der Betti steht die Wohnungstür weit offen. Drinnen machen die Leute die Schubladen auf und tragen Sachen heraus. Die Frau Schiedloh hat die Zimmerlinde unter dem Arm, die Frau Stadler die Uhr mit den gläsernen Glöckchen. Am Nachmittag kommen die SA-Männer und räumen alles aus. Zu viert tragen sie das schwere Buffet, das Kanapee macht auf jedem Treppenabsatz einen Kratzer in die Wand. In allen Türen stehen die Frauen und schauen zu. Die Frau Schobert sagt zu meiner Mutter: «Jetzt haben wir nur noch Arier im Haus.»
4
Ein fremder Geruch kommt durchs Fenster, in meinem Zimmer steht der Rauch. Unten auf der Straße blubbern die Teerblasen im Fass. Ein Mann in hohen Stiefeln und Lederschürze hält ein langes Rohr und sprüht die schwarze Brühe über den Sand. Hinter ihm fährt die Dampfwalze, immer langsam vor und zurück, den ganzen Tag, und am Abend ist die Leistnerstraße geteert.
Am nächsten Tag setzen die Männer vom Elektrizitätswerk ihre Masten ein. Flink steigen sie mit ihren Zackenschuhen bis an die Spitze der Stangen und spannen Drähte. Eine Leitung legen sie bis in die Wohnung neben uns. Kaum sind sie verschwunden, klingt dort schon das neue Telefon. Der Breiter Joseph steht im Korridor, redet und redet, wischt sich mit dem Ärmel über das Gesicht, und sobald er den Hörer an die Wand hängt, fängt es wieder an zu läuten.
Am Morgen wartet ein nagelneuer schwarzer Opel Admiral vor dem Haus, auf den Schutzblechen stecken zwei Standarte. Sobald der Herr Breiter durch den Torbogen kommt, reißt der Chauffeur den Schlag auf, schlägt die Hacken zusammen, hebt den Arm hoch und ruft: «Heil Hitler, Herr Oberbürgermeister.» Die Leute bleiben stehen und schauen zu, wie er zur Feier auf den Großdeutschland-Platz beim Rathaus gefahren wird.
Über die Straßen sind Spruchbänder gespannt: «Alle für einen, einer für alle», «Für Arbeit und Brot», «Du bist nichts, dein Volk ist alles», «Keiner soll hungern und frieren», «Ein Volk – ein Reich – ein Führer!» In den Fenstern hängen die Führerbilder und die Hakenkreuzfahnen. Durch den Adolf-Hitler-Ring rasseln die Kolonnen der Raupenfahrzeuge. Hoch oben sitzen die Soldaten, die Hände auf den Schenkeln, den Blick geradeaus, stramm und stumm wie aus Holz geschnitzt.
Auf dem Großdeutschland-Platz weht der Fahnenwald, über der Tribüne glänzen hell die Messingadler mit ihren ausgebreiteten Schwingen. Eine Marschkolonne nach der andern zieht im Paradeschritt heran, mit den Musikkapellen und Standarten, die SS-Sturmabteilung, die SS-Scharführer, die Sturmbannführer, die Obersturmführer, die Standartenführer, dann das Wehrmachtsbataillon, die SA-Männer.
Die Veteranen vom Weltkrieg haben ihre Orden an der Brust und sitzen ganz vorne auf den Ehrenplätzen, daneben die Krüppel in ihren Rollstühlen. Der Herr Pfaffinger hat das schwarze Wachstuch bis zur Brust hinaufgeknöpft. Wenn ihn die Frauen herausheben, hört er unter dem Bauch schon auf; ein französischer Tank hat ihm beide Beine abgefahren. Der Herr Stadler hat keine Hände mehr, aber er kann noch immer arbeiten. Mit seinen Armstümpfen fährt er durch die Griffe der leeren Aschentonnen und trägt sie zurück in den Hof.
Nur der Herr Hauschner fehlt. Der Kaiser hat ihm den «Pour le Mérite», die höchste Auszeichnung, persönlich an die Brust geheftet. Noch im Winter hat er zu meiner Mutter gesagt: «Der Führer ehrt seine jüdischen Kameraden, die im Weltkrieg ihr Leben für Deutschland eingesetzt und geopfert haben; wir brauchen nichts zu befürchten.» Nach Ostern bleiben sein Gartentor und die Haustüre weit offen. «Jetzt haben sie auch den Herrn Hauschner fortgetan», sagt die Mutter.
Auf der Rednertribüne gestikuliert der Oberbürgermeister Breiter mit den Händen; er macht lange Pausen und fängt dann umso stärker an zu schreien. Die Lautsprecher werfen die Wortfetzen durcheinander, und von den Häusern hallt dreifach das Echo zurück. Die «Arbeiter der Faust» fahren mit dem Kraft-durch-Freude-Schiff Wilhelm Gustloff nach Norwegen. Die «Arbeiter der Stirn» besuchen die Schulungen in der Parteizentrale Bayreuth und in München, der Hauptstadt der Bewegung. Die Mütter mit sechs Kindern erhalten das Mutterkreuz und dürfen zur Erholung ins Müttergenesungswerk. Die Berliner Großtadtkinder kommen mit der Kinderlandverschickung in den Bayerischen Wald. Die Frauen sind den Männern gleichgestellt. Frauen an die Arbeitsfront! Frauen als Schaffnerinnen! Frauen als Blitzmädel! Für jeden Deutschen einen Volkswagen!
Nach der Rede steht der Zeppelin LZ 129 über der Stadt. Grell glänzt das Aluminium in der Sonne. Er ist länger als der Stadtplatz, und die Kirchtürme scheinen winzig gegen diesen Riesen. Am Leitwerk ist ein großes Hakenkreuz aufgemalt. Am silbernen Rumpf hängen die Motoren. Sie laufen ganz langsam; schwerelos schwebt der Zeppelin in der Luft. Alle schauen zum Himmel hinauf. Deutlich sind die Köpfe in der Gondel zu sehen. Darin sitzen die feinen Leute auf Polsterstühlen und rauchen Zigarren. Daneben steht der Diener mit einer Weinflasche auf dem Tablett. Das habe ich auf einem Bild im Universum gesehen.
Der Oberbürgermeister Breiter macht alles neu, und alles wird besser als je zuvor. Die neue Trabrennbahn hat eine elektrische Startanlage und den modernsten Totalisator. Die Schießstätte ist die größte von Bayern. Zehn Schützen können nebeneinander liegen, und die Scheiben fahren auf Knopfdruck zweihundert Meter hinaus und wieder zurück. Gleich daneben hat der Bürgermeister Breiter für seinen Bruder das Gasthaus zur Schießstätt hingestellt. Über der Einfahrt steht mit gotischer Schrift: «Volk ans Gewehr!»

