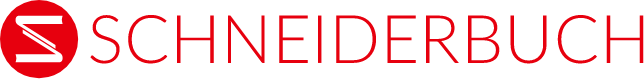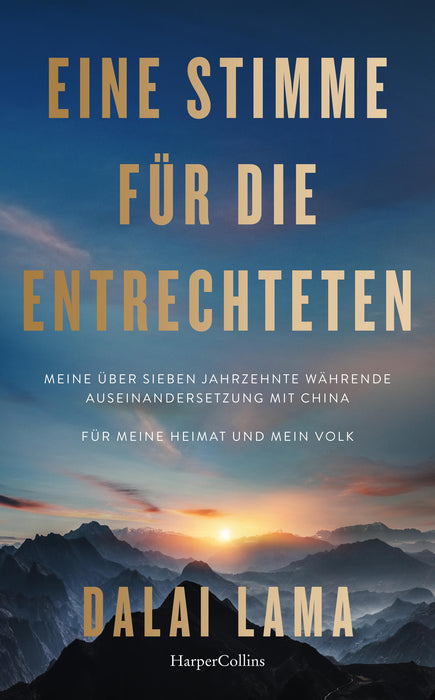
Eine Stimme für die Entrechteten. Meine über sieben Jahrzehnte währende Auseinandersetzung mit China | Für meine Heimat und mein Volk
In seinen persönlichen, spirituellen und historischen – teils nie veröffentlichten – Betrachtungen erzählt Seine Heiligkeit der Dalai Lama die Geschichte seiner 75-jährigen Auseinandersetzung mit China zur Rettung Tibets und seines Volkes.
Fast sein ganzes Leben hat der Dalai Lama mit China gerungen. Er war 16, als China 1950 sein Land annektierte. Mit 19 saß er dem Vorsitzenden Mao gegenüber, ehe er mit 25 ins indische Exil fliehen musste. Seitdem hat er den Führern Chinas – Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao und Xi Jinping – die Stirn geboten und sich gegen größte Hindernisse für Tibet, dessen einzigartige Sprache, Kultur und Geschichte eingesetzt.
Ein Dreivierteljahrhundert nach der ersten chinesischen Invasion Tibets, erinnert der Dalai Lama die Welt an den noch immer andauernden Freiheitskampf Tibets – und an die Not, der sein Volk weiterhin ausgesetzt ist. Er schildert seine Sicht auf die geopolitische Lage der Region und verrät, wie er seine Menschlichkeit allen Umständen zum Trotz bewahren konnte. Sein Buch ist das eines außergewöhnlichen Lebenswegs. Es zeigt, was es bedeutet, sein Zuhause an einen repressiven Besatzer zu verlieren, und was es heißt, mit der existenziellen Krise eines Landes umzugehen und den Glauben an eine zukünftige Lösung nicht zu verlieren.
Eine Stimme für die Entrechteten ist das eindringliche Zeugnis einer Weltikone, mit dem der Dalai Lama sowohl seinem Schmerz als auch seiner unerschütterlichen Hoffnung, die er in das Streben des tibetischen Volkes zur Wiedererlangung seiner Würde und Freiheit setzt, Ausdruck verleiht.