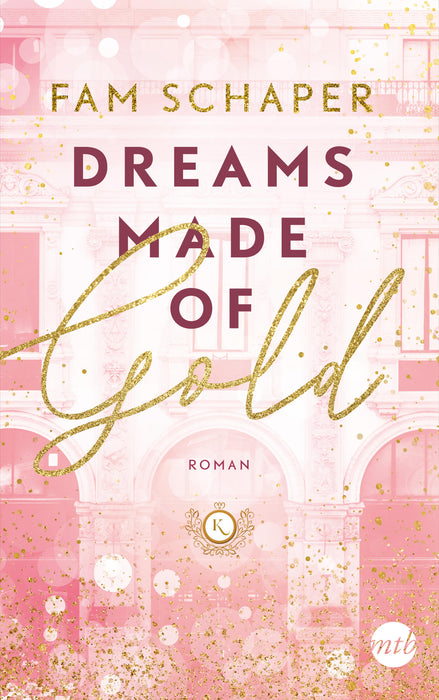Widmung
Für meine erweiterte WG
Nora, Agneya , Lea und Niklas
Danke, dass ihr mir ein zweites Zuhause geschenkt habt!
Playlist
Old Soul – Zola Simone
Insomniac – Schur
I’ll Be There for You – The Rembrandts
All We Do – Oh Wonder
Superposition – Young the Giant
Roccastrada – Luke Noa
Let’s Fall in Love for the Night – FINNEAS
Me and My Friends – James Vincent McMorrow
Trouble – Cage the Elephant
Je te laisserai des mots – Patrick Watson
Call It a Night – Toby Whyle
How to Be Yours – Chris Renzema
Such Great Heights – Iron & Wine
Our Kingdom – Hugo Barriol
How Good It Is – Morningsiders
It’ll Be Okay – Shawn Mendes
1. Kapitel
JULI
Du bist ein Puzzle, dessen Teile noch nie jemand zusammensetzen konnte. Nicht einmal du selbst.
Das hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Sie hat es lieb gemeint, aber dieser Gedanke hat mich nie ganz losgelassen. Werde ich jemals ein vollständiges Puzzle sein, wenn ich nicht einmal weiß, woher ich komme? Und stehe ich nun hier, weil ich nicht länger ein unvollendetes Puzzle sein will?
Am liebsten hätte ich diese Fragen mit einer schnellen Handbewegung verscheucht wie lästige Fliegen. Aber ich lasse es bleiben. Ich verharre schon viel zu lange an der gleichen Stelle, den Kopf in den Nacken gelegt und den Blick auf die Fassade des Gebäudes vor mir gerichtet. Ich muss den Passanten, die an mir vorbeikommen, nicht einen weiteren Grund geben, mich für seltsam zu halten.
Außerdem bin ich nicht hier, um mich zu vervollständigen. Ich bin hier, weil ich Geld brauche. Und ich bin hier, weil ich verzweifelt genug bin, um ihn nach Geld zu fragen. Das ist der einzige Grund.
Als heute Morgen ein Gerichtsvollzieher vor unserer Tür stand und unseren Strom abgedreht hat, wusste ich, dass ich keine andere Wahl mehr habe. Wenn meine Mitbewohner und ich unsere Wohnung nicht verlieren wollen, müssen wir endlich unsere Rechnungen begleichen. Und keiner von ihnen ist in der Lage, einfach mal tausend Euro zu beschaffen. Ich schon.
Meine Haare sind nass, weil ich sie mir heute nicht mal föhnen konnte. Mein Handy hat nur noch zwanzig Prozent Akku. Und mein Körper operiert inzwischen vermutlich mit noch weniger.
Ich hätte schon vor einem Monat auf seine Mails reagieren sollen. Aber ich war noch nicht bereit, mir einzugestehen, wie misslich meine Lage ist. Wenn die Gefriertruhe abzutauen beginnt, man sich keinen Kaffee mehr kochen kann und nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn kommt, kann man sich nicht länger vor den hässlichen Wahrheiten verstecken.
Ich habe es also eingesehen. Und wie heißt es so schön? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Aber dieser erste Schritt wird mir nicht helfen, wenn ich nicht in der Lage bin, auch einen in das Gebäude vor mir zu setzen.
Kaufhaus Kronenberger steht mit geschwungenen goldenen Buchstaben mehrere Meter über meinem Kopf. Obwohl ich nicht weit weg wohne, war ich noch nie hier. Ich habe dieses altehrwürdige und doch frisch verputzte Gebäude gemieden, als könnte es mich verschlingen, wenn ich mich in seine Nähe wagen würde. Auf den ersten Blick mögen die helle Fassade mit dem hübschen Stuck und die hohen Schaufenster mit den Puppen in schicken Kleidern nicht einschüchternd wirken. Doch für mich ist es der Stoff, aus dem meine Albträume gewebt sind.
Fuck.
Ich schinde nur Zeit. Es wird ja wohl nicht so schwer sein, ein Kaufhaus zu betreten. Die vielen Leute, die reingegangen sind, seitdem ich hier stehe, haben es mir schließlich bewiesen. Ich rücke mein Septum zurecht und reibe über die Blumen, die auf meinen linken Unterarm tätowiert sind. Normalerweise beruhigt mich das. Aber nicht heute.
Fuck.
Wir sind in fünf Minuten verabredet. Unmittelbar nachdem ich ihm eine Mail über mein Handy geschickt hatte, hat er mir geantwortet und mich in sein Büro eingeladen. Da auch mehrere Jahre nicht genug wären, um mich mental auf diesen Moment vorzubereiten, dachte ich, ich würde es schon schaffen, ihm eine Stunde später gegenüberzutreten.
Offensichtlich habe ich falsch gedacht.
»Fuck.« Der Fluch ist so vehement, dass ich ihn nicht länger in meinem Kopf einsperren konnte, sondern auch noch laut aussprechen musste.
»Kann man dir helfen?«
Ich zucke heftig zusammen, als mich ein Kerl von der Seite anspricht. Am liebsten würde ich ihm vorwerfen, dass man fremde Menschen nicht so erschrecken darf, aber wenigstens hat er mich aus meiner Starre gerissen, aus der ich mich nie selbst hätte befreien können.
Langsam drehe ich mich zu ihm um. Zuerst fällt mir sein ehrliches Lächeln auf. Als Nächstes entdecke ich die Starbucks-Becher und eine Tüte, die er in den Händen hält. Der Kaffeegeruch, der in meine Nase dringt, erinnert mich daran, dass ich heute noch keinen trinken konnte. Und der schicke, definitiv maßgeschneiderte Anzug, in dem der Kerl steckt, erinnert mich daran, dass ich mir so ein Kleidungsstück niemals leisten könnte, weil ich schon an meiner Stromrechnung scheitere. Er lebt unverkennbar ein ganz anderes Leben als ich.
»Alles gut«, murmle ich ein bisschen verspätet in mich hinein, während ich ihn weiter mustere, weil ich es einfach nicht lassen kann. Er hat dunkle Haare und noch dunklere Augen. Um sein Handgelenk baumelt eine Uhr, die bestimmt noch mehr gekostet hat als der Anzug. Er ist groß. Aber da ich schon eine gefühlte Ewigkeit den Kopf im Nacken liegen habe, um das Wort Kronenberger anzustarren, muss ich meine Haltung jetzt auch nicht an seine Körpergröße anpassen.
»Du siehst aus, als wüsstest du nicht, wo du hinmusst«, stellt er fest.
»Das ist nicht das Problem«, rutscht es mir raus, bevor ich es verhindern kann.
»Nein?«, fragt er. Meine kryptische Aussage scheint ihn neugierig gemacht zu haben.
»Nicht so wichtig«, sage ich nur und sehe wieder nach vorn.
Ich hoffe, dass meine abweisende Geste reicht, um ihm klarzumachen, dass Small Talk mit mir nicht dazu führen wird, dass ich ihm meine Handynummer gebe.
Doch er macht keine Anstalten weiterzugehen. »Musst du ins Kaufhaus?«
»Hm«, mache ich nur.
»Ich auch. Wenn man sich nicht auskennt, ist es da drin das reinste Labyrinth. Komm, ich helf dir.«
Widerwillig drehe ich mich wieder zu ihm um. Meine Augenbrauen ziehe ich zusammen, wie ich es immer tue. Wenn mir keine guten Entgegnungen einfallen, lasse ich sie das Antworten übernehmen. Sie sind sehr ausdrucksstark. Das behaupten zumindest meine Freunde.
»Ich arbeite im Kaufhaus«, erklärt er.
Ich wollte sein Angebot schon ablehnen, doch nun schlucke ich die Worte wieder runter. Hilfe anzunehmen ist mir noch nie leichtgefallen. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich die Büros finden soll. Die sind vermutlich nicht öffentlich ausgeschildert wie die Feinkost- oder Unterwäscheabteilung.
»Ich habe einen … Termin«, setze ich zögerlich an. »Mit Joachim Kronenberger.« Der Name fühlt sich seltsam in meinem Mund an. Er scheint sich gegen mich zu wehren. Das war schon immer so. Deswegen habe ich ihn nur dann ausgesprochen, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Die Augen des Kerls weiten sich. »Du bist Juli Forster.«
Mein Herz beginnt zu rasen. Er hat nur meinen Namen gesagt, aber sofort frage ich mich, ob er auch die Wahrheit kennt, die dahintersteckt.
»Ja«, kriege ich hervor. »Woher weißt du das?«
»Oh sorry«, sagt er und nimmt die Tüte und die Kaffeebecher in der Halterung in die linke Hand, damit er mir die rechte entgegenstrecken kann. »Keine Sorge. Wildfremde Menschen auf der Straße wissen nicht einfach, wie du heißt. Ich bin der Assistent von Joachim Kronenberger. Er hat deinen Namen in den Terminkalender geschrieben und mich gebeten, euch was zum Trinken und Essen zu holen.«
Meine Hand zittert ein bisschen, als ich seine entgegennehme. Aber ich glaube nicht, dass es ihm auffällt.
»Ich bin Isaac Jordan.«
Seinen Vornamen spricht er englisch aus, seinen Nachnamen deutsch, aber mein Kopf ist noch zu laut, um sich über so etwas wundern zu können.
Ich nicke nur, weil ich keinen Ton herauskriege.
»Dann bringe ich dich mal zu seinem Büro«, sagt Isaac ganz selbstverständlich und läuft zielstrebig auf die Tür zu. Als ihm auffällt, dass ich ihm nicht folge, schaut er über seine Schulter. »Kommst du?«, fragt er nach. Falls ihn mein Zögern irritiert, lässt er es sich zumindest nicht anmerken.
»Hm«, mache ich nur, atme einmal tief durch und setze einen Schritt nach vorn. Und dann den nächsten. Bis ich Isaac erreicht habe, der mir immer noch die Tür aufhält. Meine Beine fühlen sich instabil an, sobald mein Fuß zum ersten Mal den Boden im Kaufhaus Kronenberger berührt. Aber meine Knie knicken wider Erwarten nicht unter mir weg. Sie tragen mich weiter.
Bis ich die Halle direkt vor den Rolltreppen erreiche. Dann halte ich abrupt inne. An diesem Ort habe ich das Gefühl, die Anwesenheit von Geheimnissen körperlich spüren zu können. Das größte Geheimnis der Familie Kronenberger bin wohl ich. Und gerade fühlt es sich so an, als wäre ich in diesen Mauern, die Reichtum, Tradition und ein makelloses Familienimage tragen, eingesperrt worden.
Obwohl meine letzte Panikattacke mehrere Jahre zurückliegt, wende ich die Schritte, die mir damals geholfen haben, damit klarzukommen, auch heute noch an. Sie bewahren mich davor, in der Panik zu ertrinken, sie helfen mir zu schwimmen, wenn meine Ängste, Unsicherheiten und Gefühle zu hohe Wellen schlagen.
Ich beschreibe fünf Dinge, die ich sehe. Unter meinen Füßen ziehen sich dunkle Maserungen durch den weißen Marmorboden, der frisch poliert aussieht, obwohl heute schon Hunderte Menschen über ihn gelaufen sein müssen. Überall hängen Hochglanzplakate, von denen wunderschöne Menschen auf mich herabstrahlen. Ich muss den Blick abwenden. Ihr Gesichtsausdruck kommt mir zu perfekt vor, um echt zu sein, und sie lassen mich an all die Lügen denken, die eine Reihe strahlend weißer Zähne verbergen können. Über meinem Kopf hängt ein Kronleuchter, der mir mindestens so groß vorkommt wie ein Kleinwagen. Seine Kristalle reflektieren das Licht, das von den gut ausgeleuchteten Vitrinen ausgeht. In den Vitrinen wird teures Make-up verkauft. In einer Auslage entdecke ich den roten Lippenstift, den mir meine Freunde zu Weihnachten geschenkt haben. Und die Lidschattenpalette, die ich mir schon sehr lange wünsche, aber noch nicht leisten konnte. Und irgendwie hilft es mir, mich an etwas festzuhalten, das ich kenne, während ich drohe in einem Ort unterzugehen, der auf eine verquere Weise mit mir verbunden ist, mich aber immer ausgeschlossen hat.
Eigentlich müsste ich noch fünf Dinge beschreiben, die ich höre, und fünf Dinge, die ich fühle. Aber mein Herzschlag hat sich bereits beruhigt, und Isaac steht immer noch neben mir und sieht mich fragend an.
»Ich wollte den Ort auf mich wirken lassen«, erkläre ich und bin damit ja nicht einmal so weit von der Wahrheit entfernt.
»Warst du noch nie hier?«, fragt er und läuft zu der Rolltreppe. Ich folge ihm. In Bewegung zu bleiben hilft tatsächlich. Dann kommt es mir so vor, als würde ich mich gegen die Strömung dieses Ortes wehren, statt mich von ihr mitreißen zu lassen.
»Nein«, sage ich knapp.
»Dann bist du nicht aus München, oder?«
»Doch.«
Ich warte auf die nächste Frage, doch sie bleibt aus. Isaac führt mich im dritten Stock wortlos an dem Porzellan und den ausgestellten Federbetten vorbei und auf eine Tür zu. Er hält eine Karte an einen Sensor, und die Tür schwingt auf. Mit einer Geste bedeutet er mir, vorauszugehen.
Wir betreten ein Treppenhaus, das so viel ruhiger ist als das Kaufhaus, dass ich die Abwesenheit von Lautstärke deutlich in meinen Ohren spüren kann.
Isaac führt mich durch einen Gang, von dem unsere Schritte widerhallen, und dann noch einen Treppenabsatz hinauf.
»Wir sind gleich da«, meint er, und fast klingt das wie eine Drohung.
Mein Herzschlag wird wieder stärker und ist irgendwann auch lauter als meine Schritte. Aber ich gestatte es mir nicht, langsamer zu werden. Ich bin schon so weit gekommen.
Isaac tritt in eine Art Vorraum mit einer Garderobe und einem Arbeitsplatz. So selbstverständlich, wie er sein Portemonnaie auf einen Schreibtisch legt, gehe ich davon aus, dass es seiner ist. Ohne mich vorzuwarnen, läuft er auf eine geschlossene Tür zu, klopft und öffnet sie auch schon.
»Joachim, Juli Forster ist da«, sagt er in das Zimmer hinein, das ich nicht sehen kann, weil ich mich noch nicht getraut habe, näher zu treten. Meine letzte Panikattacke kommt mir in diesem Moment gar nicht so lange her vor.
Isaac verschwindet in dem Raum. Der Impuls, einfach abzuhauen, wird so groß, dass ich kaum noch gegen ihn ankomme. Aber ich gehe weiter, und es fühlt sich so mühsam an, als würde ich durch Wasser laufen.
Und dann stehe ich auch schon in der geöffneten Tür und Joachim Kronenberger gegenüber. Er hat sich von seinem Schreibtischstuhl erhoben, um die Kaffeebecher und die Papiertüte anzunehmen, die Isaac ihm reicht. Er trägt auch einen schicken Anzug, der zu gut sitzt, um von der Stange zu sein, und hat die grau melierten Haare zurückgegelt.
Als er mich sieht, erstarrt er.
Da ist er nun also. Ich werde niemals in der Lage sein, zuzugeben, wie oft ich mir genau diesen Moment schon ausgemalt habe. Aber meist sah das Szenario anders aus. Es war aufregender, lauter, spektakulärer. Worte wurden geschrien, Tränen geweint und Umarmungen ausgetauscht. Jetzt wird mir klar, dass ich wohl zu viele Opern gesehen habe, weil die Dramatik in meinen Vorstellungen definitiv auf eine Bühne gehört und nicht in ein schlichtes Büro.
»Brauchst du noch etwas?«, fragt Isaac. Ein normaler Assistent duzt seinen Chef wohl nicht und trägt auch keinen maßgeschneiderten Anzug und eine teure Uhr. Aber das ist genauso wenig mein Problem wie sein englisch-deutscher Name. Wenn das Gespräch, das mir bevorsteht, so abläuft, wie ich geplant habe, werde ich Isaac Jordan ohnehin nie wiedersehen.
»Juli«, flüstert Joachim Kronenberger fast schon bedächtig. Ich kenne seine Stimme. Nach dem Tod meiner Mutter hat er mich angerufen. Doch unser erstes und letztes Gespräch hat damit geendet, dass ich ihm aufgebracht mitgeteilt habe, dass ich keinen Cent mehr von ihm haben will und er sich seine Unterhaltszahlungen sonst wohin stecken kann. Seitdem habe ich wirklich kein Geld mehr von ihm erhalten, und nun sehe ich ja, wohin mich das gebracht hat. Direkt zu ihm.
Damals dachte ich, er würde nach diesem Telefonat nie wieder versuchen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Aber das war nicht der Fall. Einmal im Monat hat er mir eine Mail geschickt. Heute hat er das erste Mal eine Antwort bekommen.
»Hallo«, krächze ich mit belegter Stimme, weil ich keine Ahnung habe, wie ich ihn ansprechen soll.
»Isaac«, sagt er und wendet sich an seinen schicken Assistenten. »Darf ich dir Juli vorstellen, meine … Tochter.«
Dieses Wort schlägt in diesem Zimmer ein wie ein Blitz. Und bringt Isaac dazu, mich aus riesigen Augen anzustarren.
Eigentlich ist das Wort Tochter harmlos. Aber nicht, wenn man Joachim Kronenberger heißt, ein erfolgreicher Unternehmer ist, zwei wunderschöne Kinder und eine glückliche Ehefrau hat. Der Inhaber des bekanntesten Luxus-Kaufhauses Deutschlands, das seit Generationen von Kronenbergers geführt wird, hat keine Affäre und schon gar nicht ein uneheliches Kind, das er noch nie getroffen hat. So etwas passiert in so einer guten Familie einfach nicht.
Zumindest denkt das die Öffentlichkeit.
Und bis vor wenigen Sekunden dachte das auch noch Isaac Jordan.
Ich kann nicht fassen, dass der Mann, der für mich nie ein Vater war, seinem Assistenten gesagt hat, wer ich wirklich bin. Ich war mein ganzes Leben lang sein Geheimnis. Schon als ich aufgehört habe, an den Weihnachtsmann zu glauben, habe ich aufgehört, darauf zu warten, dass er sich jemals zu mir bekennen würde. Ich wusste, was ich von ihm zu erwarten habe. Diese Gewissheit droht nun zu bröckeln.
Seine Mails habe ich für einen Versuch gehalten, mich wieder zu kontrollieren. Wenn er mir kein Geld gibt, kann er sich auch nicht mein Schweigen kaufen, wie er es all die Jahre getan hat. Das macht mich zu einer Bedrohung für sein makelloses Image, und das konnte er nicht so stehen lassen. Diese Erklärung erschien mir sehr logisch. Aber wenn er sein Geheimnis hüten will, wieso teilt er es mit seinem Assistenten?
In meinem Kopf wird es immer lauter. Deswegen überrascht es mich, dass ich ihn verstehen kann, als er wieder das Wort ergreift.
»Du kannst schon in die Mittagspause. Ich möchte mich allein mit Juli unterhalten«, sagt der Mann, für den mir nie ein richtiger Begriff eingefallen ist.
Isaac räuspert sich umständlich. »Alles klar.« Er versucht, mich nicht mehr anzustarren. Aber es gelingt ihm nicht. Erst als die Tür wieder hinter uns ins Schloss fällt, lässt mich auch sein Blick los.
»Möchtest du dich nicht setzen?«, fragt mich der Fremde vor mir, der sich doch nicht wie ein Fremder anfühlen will, und deutet auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. Mit steifen Gliedern komme ich seiner Aufforderung nach. Ich schaue ihn immer noch an, obwohl mich sein Anblick auch wütend macht.
Ich sah meiner Mutter nie sonderlich ähnlich, doch in seinem Gesicht finde ich gleich mehrere Merkmale, die uns miteinander verbinden. Ist das nicht ironisch? Ausgerechnet von dem Elternteil, das mich immer verstecken wollte, habe ich den Schwung meiner Nase, das Blau meiner Augen und die eckigen Brauen geerbt – die Wahrheit über meine Herkunft ist mir also ins Gesicht geschrieben.
Er reicht mir einen Kaffeebecher, und ich bin froh, dass ich nun weiß, was ich mit meinen Händen machen soll. Dann packt er auch noch zwei Blaubeer-Muffins aus und will mir einen geben. Ich wehre ab.
»Willst du nichts essen?«, fragt er.
»Schon. Aber ich habe eine Glutenunverträglichkeit«, sage ich.
»Oh«, macht er nur. Aber was will er dazu auch sagen? Ein richtiger Vater hätte das gewusst.
Wir schweigen eine unangenehme Unendlichkeit lang, die mein restliches Leben anzuhalten scheint. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich durch das Fenster, das hinter ihm liegt, den Wechsel der Jahreszeiten hätte verfolgen können.
»Ähm«, setzt er irgendwann an und stockt sofort wieder. »Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur«, sagt der Mann, mit dem ich mir meine Gene teile und das erste Mal in meinem Leben die Luft zum Atmen.
»Danke«, murmle ich in mich hinein und trinke einen Schluck Kaffee, weil sich mein Rachen auf einmal so furchtbar trocken anfühlt. Dass ich die Prüfungen diesen Sommer nachgeholt habe, weil ich sie vor zwei Jahren nach dem Tod meiner Mutter abgebrochen habe, erwähnen wir beide nicht.
»Ich wollte dir ein Geschenk schicken, aber weil du nicht auf die Mails geantwortet hast …« Er lässt den Rest des Satzes offen, aber das scheint ihn nicht leichter zu machen. Ganz im Gegenteil. Die ungesagten Silben hängen schwer zwischen uns.
»Alles gut. Ich habe nicht mit einem Geschenk gerechnet.« Ich wollte die dicke Stimmung erträglicher machen. Stattdessen habe ich es verschlimmert. Denn mein Satz klingt nicht wie eine lockere Entgegnung, sondern wie ein aufgeladener Vorwurf. Dass ich es genauso meine, merke ich aber erst, als mir die Worte schon entkommen sind.
Dieses Gespräch ist noch viel zäher, als ich erwartet hätte, und ich habe nicht gerade mit einer fließenden Unterhaltung gerechnet.
»Und das mit deiner Mutter …« Jetzt erwähnt er sie doch, und ich wünschte, er hätte es nicht getan. »Mein Beileid.«
Ich fühle mich in der Zeit zurückversetzt. Vor zwei Jahren sind diese Worte aus meinem Handylautsprecher gedrungen und haben eine unbändige Wut in mir ausgelöst. Auch jetzt spüre ich sie wieder in mir aufsteigen. Ich will wieder schreien. Ich will ihm wieder sagen, dass ich ihn niemals gebraucht habe, nicht brauche und niemals brauchen werde. Aber die Tatsache, dass ich jetzt vor ihm sitze, würde alles sofort entkräften. Also schlucke ich den Rest meines Stolzes hinunter, den ich nicht schon auf dem Weg hierher verloren habe, und versuche mir ein Lächeln abzuringen.
»Es ist schon zwei Jahre her«, gebe ich meine Standardantwort, die ich immer parat habe, wenn jemand auf meine Mutter zu sprechen kommt. Wenn ich diesen Satz nur oft genug sage, kann ich vielleicht auch irgendwann glauben, dass Trauer ein Verfallsdatum hat.
Joachim Kronenberger ist schon wieder bei dem Versuch, ein Gespräch mit mir zu beginnen, gescheitert. Wie oft wird er noch ansetzen, bevor er endgültig aufgibt?
»Was machst du jetzt?«, fragt er und drückt seinen Kaffeebecher ein bisschen zu fest. Eine Delle hat sich in der Pappe geformt, wo gerade noch sein Daumen geruht hat.
»Ich arbeite als Aushilfe in einem Friseursalon«, erwidere ich. Dass ich zu wenig verdiene und meine Tage damit verbringe, Haare aufzufegen, ans Telefon zu gehen, zu putzen und von einer cholerischen Chefin angeschrien zu werden, lasse ich lieber weg.
»Möchtest du Friseurin werden?« Ich kann ihm seine Erleichterung deutlich ansehen, dass er nun schon die zweite Frage stellt, ohne dass wir in ein peinliches Schweigen verfallen sind.
»Nein.« Ich will ihm eigentlich nicht mehr erzählen, weil es ihm nicht zusteht, irgendwas über mich zu wissen. Aber ich zwinge mich, weiterzusprechen. Je schneller ich dieses Gespräch hinter mir habe, desto schneller kann ich auch wieder von hier verschwinden. »Ich will Maskenbildnerin werden.«
Er wirkt ehrlich interessiert. Mein Herz will sich darüber schon freuen, doch ich verbiete es ihm. Joachim Kronenberger verdient es nicht, dass ich ihm zwanzig Jahre Abwesenheit einfach so verzeihe.
»Hast du dich schon beworben?«, hakt er nach.
»Die Bewerbungsfristen sind im Januar. Bis dahin arbeite ich an meiner Mappe.« Wieder lasse ich mehr aus, als ich tatsächlich ausspreche. Im letzten Jahr habe ich mich bei der Oper und bei Theatern in München beworben. Ich wurde nicht genommen. Ich hätte meine Mappe an Spielhäuser im ganzen Land schicken sollen. Doch München ist meine Heimat. Ich kann hier nicht weg.
»Und bis dahin jobbst du?«
»Ja.«
Wieder ist da diese aufgeladene Stille zwischen uns, die Geschichten über all das zu erzählen scheint, was wir nicht wagen auszusprechen.
Mein Erzeuger räuspert sich, trinkt einen großen Schluck Kaffee und räuspert sich noch mal. Die Muffins hat er immer noch nicht angerührt. Vermutlich ist es ihm unangenehm, wenn ich sie nicht essen kann.
»Ich habe mich sehr gefreut, als ich deine Mail gelesen habe.«
Ich nicke, weil mir keine Antwort einfällt.
»Ich will schon seit einer Weile mit dir reden, aber ich wollte warten, bis du bereit bist.«
Endlich kommen wir zur Sache. Ich unterdrücke ein Aufseufzen. Er wird mir sagen, warum er mir zu jedem Ersten des Monats eine Mail geschrieben hat wie ein zuverlässiges Uhrwerk. Und dann werde ich dieses Kaufhaus wieder verlassen und es nie wieder betreten.
»Es tut mir leid, dass unser Gespräch damals so abgelaufen ist. Sehr vieles tut mir leid. Aber in den letzten Jahren ist einiges passiert, was mir die Augen geöffnet hat. Der Unfall …« Er bricht ab. Und das erste Mal, seitdem ich sein Büro betreten habe, ist es nicht meine Schuld, dass er an seinen eigenen Worten scheitert. Ich warte darauf, dass er über die Tragödie redet, die vor einem Jahr seine Familie erschüttert hat. Doch ich warte vergebens, denn er räuspert sich einfach und fährt fort. »Viele Fragen sind noch offen, die ich schon vor Jahren hätte klären sollen.«
»Und die wären?«
»Dein Erbe zum Beispiel.«
Ich ziehe meine Augenbrauen hoch, weil mir keine passenden Worte einfallen wollen.
»Als meine Tochter steht dir Geld zu, wenn ich sterbe.«
»Ich dachte, weil niemand von mir weiß …« Diesmal bin ich diejenige, die einen Satz nicht beenden kann. Schon wieder finde ich eine Gemeinsamkeit, die ich niemals entdecken wollte.
»Mein Name steht auf deiner Geburtsurkunde. Es besteht kein Zweifel daran, wer dein Vater ist. Niemand kann dir deinen rechtmäßigen Anteil streitig machen.«
Das wusste ich nicht. Ich habe geglaubt, dass er sichergegangen ist, dass es keine Hinweise auf unsere Verbindung gibt. Abgesehen von den monatlichen Unterhaltszahlungen, die meine Mutter achtzehn Jahre lang erhalten hat.
Aber anscheinend habe ich keine Ahnung, was er will, warum er mir diese Mails geschickt hat und mich treffen wollte.
Auf einmal scheine ich die Bodenhaftung zu verlieren. Meine Vorurteile haben mich geerdet. An ihnen konnte ich mich festhalten. Jetzt bricht alles zusammen, was ich geglaubt habe, über Joachim Kronenberger zu wissen. Und der Vorsatz, mit dem ich hierhergekommen bin, droht mir zu entgleiten.
»Darüber wolltest du mit mir reden? Mein Erbe?«, frage ich, um mir vorzumachen, ich hätte noch Kontrolle über mich, meine Selbstachtung und meine Gefühle.
»Nicht nur«, meint er. »Ich wollte dich endlich kennenlernen.«
Mein Herz bleibt stehen. Und ich kann nichts anderes tun, als ihn einfach anzustarren, weil mein Körper gemeinsam mit meinem Herzen erstarrt ist.
Ihm scheint es nicht aufzufallen, dass ich mich kurzzeitig in eine Statue verwandelt habe, denn er redet weiter.
»Es würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft öfter sehen könnten. Und auch deine Familie würde ich dir gern vorstellen.«
»Meine Familie?«, entfährt es mir schrill. »Kennenlernen? Du willst, dass ich …« Ungläubig schüttle ich den Kopf.
»Es ist überfällig.«
»Du willst mich deiner Ehefrau vorstellen?« Ich kann nicht verhindern, dass ich spöttisch klinge. Aber das ist immer noch besser, als wenn er mir anhören könnte, dass ich mir in meinen dunkelsten Momenten immer gewünscht habe, Teil einer Familie zu sein, die mich niemals wollte.
»Es wird ein Schock sein«, beginnt er. »Aber ich will, dass du auch deine Geschwister triffst.«
»Halbgeschwister«, sage ich ganz automatisch.
Das erste Mal, seit ich hier sitze, entgleist ihm sein frustrierend neutraler Gesichtsausdruck. Er zuckt beim Klang des Wortes leicht zusammen. Und der erbärmlichste Teil in mir fühlt sich sofort schuldig. Ich muss mich ermahnen, dass ich ihm nichts schulde. Schon gar nicht ein schlechtes Gewissen.
»Ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin«, kriege ich irgendwie an dem Kloß in meinem Hals vorbei. Ich bin hier, weil ich Geld brauche, nicht eine Familie.
Bei der Vorstellung, allen Kronenbergers gegenüberzustehen, steigt meine Panik an wie der Wasserspiegel bei Flut und droht mich so lange unter die Oberfläche zu drücken, bis ich wirklich keine Luft mehr bekomme.
»Das verstehe ich«, sagt er schnell und hebt abwehrend die Hände. »Wärst du denn bereit, mich kennenzulernen?«
Fuck.
Er meint es ernst. Er hat mir immer wieder geschrieben, obwohl ich ihn abgewiesen habe. Er hat mich in sein Büro eingeladen, ins Kronenberger Kaufhaus, den Ort, der seiner Familie gehört. Er hat seinem Assistenten meine wahre Identität verraten. Das bedeutet etwas.
Doch der Selbstschutzmechanismus, den ich mir schon in meiner Kindheit antrainiert habe, ist stark und lässt sich nicht einfach ausschalten. Joachim Kronenberger hat mein Vertrauen nicht verdient, und dass er sich nach zwanzig Jahren entschlossen hat, eine Beziehung zu mir aufzubauen, heißt noch lange nicht, dass ich ihm das auch zugestehe.
»Ich weiß nicht«, kriege ich hervor. »Ich hätte nicht gedacht, dass du das willst.«
»Warum hätte ich dich sonst sehen wollen?«
Wie soll ich ihm sagen, dass ich dachte, dass er sich mein Schweigen erkaufen wollte, wenn er mich so hoffnungsvoll ansieht?
Aber ich muss es nicht aussprechen, er scheint es an meinem Gesicht abzulesen. Wieder verzieht sich seine Miene. Wieder fühle ich etwas tief in meiner Brust, was ich auf gar keinen Fall fühlen will.
»Warum bist du heute gekommen?« Eigentlich bin ich dankbar, dass er nicht noch mal auf seine letzte Frage eingeht, aber die ist auch nicht viel angenehmer.
Ich wollte sein Geld. Aber ihn darum zu bitten, wenn er mich kennenlernen will, ist auf einmal unmöglich. Mein Hals wird eng und meine Hände schwitzig. Warum ist das so verdammt schwer? Meinen Stolz habe ich doch längst runtergeschluckt.
»Hast du ein Problem?« Er klingt ehrlich besorgt. »Du kannst es mir sagen.«
Warum ist mein Gesicht ausgerechnet heute ein offenes Buch? Sonst kann ich meine Gefühle nicht nur erfolgreich vor anderen, sondern auch vor mir selbst verstecken. Doch heute gilt nichts, was sonst so klar gewesen ist.
»Ja«, sage ich schließlich widerwillig. »Heute wurde mein Strom abgestellt.« Man sagt ja immer, man soll ein Pflaster so schnell wie möglich abziehen, dann tut es weniger weh. Das Sprichwort stimmt nicht. Es hat verdammt wehgetan, das zuzugeben.
»Warum?«
»Weil ich die Rechnungen nicht bezahlen konnte.« Irgendwie schaffe ich es, das überbrodelnde Chaos in meinem Inneren wieder hinter einem gleichgültigen Gesichtsausdruck und einer ruhigen Stimmlage zu versiegeln.
»Du hast Geldprobleme?«
Ich nicke. Das werde ich niemals laut zugeben können.
»Das ist meine Schuld«, sagt er zu meiner Überraschung. »Ich hätte dir weiterhin Unterhalt zahlen sollen. Es steht dir zu.«
Das mag in irgendeinem Gesetz so festgeschrieben sein, trotzdem komme ich mir vor, als würde ich um etwas betteln, das mir nicht zusteht. Ich fühle mich eklig, meine Haut scheint klebrig zu sein.
»Ich würde nicht fragen, wenn ich nicht müsste«, meine ich.
»Du kannst immer fragen«, entgegnet er mit Nachdruck. Er zückt ein Blatt Papier und einen Stift und fragt mich, wie mein Stromanbieter heißt und wie viel Geld ich ihm schulde. Über so etwas Unpersönliches zu sprechen, hilft mir, mich wieder wohler in meiner Haut zu fühlen. Wenn auch nur ein bisschen.
»Und wie viel Geld brauchst du im Monat?« So fachmännisch klingt er vermutlich auch, wenn es ums geschäftliche Budget geht.
»Wenn sie den Storm nicht abgestellt hätten, hätte ich nie um Geld gefragt. Ich will keine Almosen«, sage ich, obwohl mir inzwischen klar sein sollte, dass ich in wenigen Monaten wieder hier sitzen werde, wenn ich nicht annehme, was er mir bieten will.
Joachim Kronenberger schüttelt vehement den Kopf. »Es sind keine Almosen. Das Geld steht dir zu«, wiederholt er.
Ich will mich weiter wehren, einfach, um nicht nachzugeben. Denn das würde einer Niederlage gleichkommen. Aber er lässt sich von meinem Schweigen nicht irritieren.
»Wann würde deine Ausbildung zur Maskenbildnerin anfangen?«
Der Themenwechsel überfordert mich. Ich brauche einen Moment, um zu antworten. »Nächstes Jahr im September.«
»Bis dahin wirst du vermutlich weiter arbeiten.«
»Ja.«
»Verdienst du gut als Aushilfskraft?«
Mir entfährt ein Lachen.
»Das ist wohl ein Nein«, stellt er fest. Sein rechter Mundwinkel zuckt. Es ist nur ein vorsichtiges Lächeln. Und es ist so schnell verschwunden, wie es gekommen ist. Aber ich habe es gesehen. Und es war echt. Schon das reicht, um mich wieder aus der Bahn zu werfen, die ich doch gerade erst wiedergefunden hatte.
»Also brauchst du einen Job, mit dem du dich bis September finanzieren kannst«, fährt er fort.
»Ja.«
»Ich würde dir wieder Unterhalt zahlen, aber wenn du das nicht willst, habe ich einen anderen Vorschlag. Ich könnte dir einen Job besorgen, bei dem du besser verdienst, damit du gut über die Runden kommst. Du würdest dir das Geld selbst verdienen. Es wäre nicht geschenkt.«
Auf einmal fällt mir das Atmen wieder ein bisschen leichter. Das ist eine Lösung, mit der ich leben kann. Ich wäre nicht von ihm abhängig. Ich wäre keine Bittstellerin, die ihren Stolz aufgeben muss, um ihre Stromrechnung begleichen zu können.
»Welcher Job wäre das?« Meine Stimmlage ist weniger kühl als eben noch. Die Hoffnung, aus dieser Situation, die mir heute Morgen noch so aussichtslos erschienen ist, herauszukommen, hat sie aufgewärmt.
»Da du Maskenbildnerin werden willst, gehe ich davon aus, dass du dich mit Haaren und Make-up auskennst.«
»Ja«, sage ich. Im Verlauf des ganzen Gespräches war meine Stimme nicht so fest wie jetzt.
»Dann könntest du in dem Bereich arbeiten.«
Ein Lächeln will sich in meinem Gesicht ausbreiten. Ein richtiges. Das ist doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. »Das klingt gut.«
»Das freut mich«, sagt der Fremde, mit dem ich mir meine Gesichtszüge teile. »Dann kannst du am Montag hier im Kaufhaus anfangen.«
Das Lächeln zerbricht auf meinen Lippen, bevor es sich endgültig formen konnte. Das war alles tatsächlich zu schön, um wahr zu sein.
2. Kapitel
ISAAC
»Isaac, bist du dabei?«
Die Stimme meines Bruders reißt mich unsanft aus meinen Gedanken, in denen ich so tief versunken war, dass ich jetzt einige Sekunden brauche, um in die Realität zurückzukehren.
Ich muss mehrmals blinzeln und mich umsehen, um zu verstehen, wo ich bin. Wir sitzen draußen vor einem Restaurant. An den Tischen um uns unterhalten sich andere Menschen angeregt miteinander. Wie wir machen sie wohl gerade Mittagspause und genießen das sonnige Herbstwetter, bevor sie ins Büro zurückkehren müssen.
Vor mir steht ein Teller Nudeln, den ich kaum angerührt habe. Matthew hat seine Portion längst verschlungen. Wie lange folge ich diesem Gespräch schon nicht mehr?
An den verwirrten Gesichtsausdrücken von Lorena und Johann, die mir gegenübersitzen, kann ich ablesen, dass es eine ganze Weile gewesen sein muss.
»Hast du überhaupt mitbekommen, worüber wir gesprochen haben?«, fragt mein Bruder lachend und schnappt sich, ohne zu fragen, ein paar Nudeln von meinem Teller. Er macht das, seit wir kleine Kinder waren, und ich habe schon vor Ewigkeiten aufgehört, mich darüber zu beschweren. Es bringt sowieso nichts.
»Nein, sorry«, murmle ich in mich hinein und trinke einen großen Schluck Wasser, weil meine Stimme so rau klingt.
»Geht’s dir gut?«, fragt Lorena besorgt und beugt sich mir über den Tisch entgegen. Sie hebt ihre Hand, als wollte sie mir diese auf die Stirn legen, um meine Temperatur zu messen. Im letzten Moment entscheidet sie sich dagegen und lässt sie wieder sinken. Matthew wirft mir einen vielsagenden Blick von der Seite zu, doch ich tue so, als hätte ich weder Lorenas Geste noch seine erhobenen Augenbrauen bemerkt.
»Ja, alles gut«, sage ich ausweichend.
»Beruhig dich, Lorena«, ermahnt Johann sie. »Isaac ist nicht zerbrechlich.«
Sie sieht nicht überzeugt aus, aber sie traut sich nicht, mehr zu sagen. Früher sind wir anders miteinander umgegangen, aber im letzten Jahr hat sich viel verändert.
»Es ist wirklich alles gut. Ich denke nur über vieles nach«, versichere ich ihr beschwichtigend und versuche gelassen zu wirken. Es fällt mir nicht leicht. Denn Juli Forster hat jede Ecke meines Kopfes eingenommen. Und seit ich Lorena und Johann gegenübersitze, scheinen alle meine Gedanken an sie nur noch lauter geworden zu sein.
Ich kenne Lorena und Johann, seit ich denken kann. Unsere Eltern waren schon immer die engsten Freunde. Wir haben unsere Kindheit zusammen verbracht. Und nun weiß ich, dass die beiden eine Schwester haben, von der sie noch nie gehört haben, und ich darf es ihnen nicht verraten.
Die wahre Identität von Juli Forster hat so viel Sprengkraft, dass ich eigentlich auch nicht in der Nähe sein will, wenn diese Granate hochgeht. Wie viel wird von der Familie Kronenberger, wie ich sie kenne, noch übrig bleiben, wenn sie von ihr erfahren?
Ich will nicht an sie denken. Doch darüber habe ich gerade keine Kontrolle. Ganz von allein versuche ich mir all die Fragen zu beantworten, die ihre Existenz mit sich bringt. Ich habe sie nur kurz gesehen, aber sie ist definitiv jünger als Johann, vermutlich ist sie auch jünger als Lorena. Das bedeutet, sie ist zur Welt gekommen, als ihr Vater längst verheiratet war. Dass Joachim Kronenberger seine Frau betrogen hat, will nicht zu dem Mann passen, den ich schon mein ganzes Leben lang kenne. Und dass er seine eigene Tochter verstecken würde, noch weniger. Aber wie unlogisch es mir auch erscheinen mag, ich kann die Tatsachen nicht leugnen. Juli Forster ist eine Kronenberger. Und wenn sie ihren Vater in seinem Büro trifft, kann das nur bedeuten, dass er sie dem Rest der Familie vorstellen will.
Mein Blick fällt auf Lorena. Sie sieht Juli nicht ähnlich. Die dunklen Haare und die weichen Züge hat sie von ihrer Mutter geerbt. Juli kommt nach ihrem Vater. Sie ist unverkennbar seine Tochter. Selbst wenn ich die Wahrheit noch leugnen wollte, würde ihr Gesicht sie verraten.
»Isaac?« Mein Bruder stupst mich diesmal mit dem Ellbogen an. Dass ich wieder aus dem Gespräch ausgestiegen bin, hat er genutzt, um weitere Nudeln von meinem Teller zu essen. Es ist fast nichts mehr übrig. Aber wieder beschwere ich mich nicht. Ich habe ohnehin keinen Hunger.
»Matt?«, gebe ich nur zurück.
»Bist du jetzt also dabei?«
»Bei was?«, frage ich zurück.
Matt verdreht die Augen, Johann grinst in sich hinein, Lorena sieht mich immer noch besorgt an.
»Wir wollen am Wochenende in eine neue Bar gehen. Bist du dabei?«, fragt mich mein Zwillingsbruder nun schon zum dritten Mal. Er klingt ein bisschen genervt, aber das ist schon seit einiger Zeit seine bevorzugte Stimmlage.
»Klar«, meine ich und versuche so zu tun, als würde ich mich darauf freuen, obwohl mein Kopf schon wieder abdriften will.
»Ich verstehe gar nicht, warum du uns überhaupt mitnehmen willst«, sagt Johann an Matt gewandt. »Du wirst uns ohnehin nach zehn Minuten sitzen lassen, um mit irgendeiner Frau zu flirten, und uns den restlichen Abend nicht mal mehr angucken.«
»Mag sein«, sagt Matt fast unbeteiligt.
Unwillkürlich zieht sich mein Magen zusammen. Das tut er immer, wenn ich daran denke, wie mein Bruder früher war und wie er heute ist. Im letzten Jahr hat sich vieles verändert, wir alle haben uns verändert, aber niemand so stark wie Matt. Manchmal, wenn ich ihn anschaue, habe ich das Gefühl, einen Fremden zu betrachten, obwohl wir uns doch so verdammt ähnlich sehen. Früher konnte er sich über so vieles freuen, auch über die alltäglichsten Dinge. Er hat sich über die Anzüge lustig gemacht, die ich bei der Arbeit anhabe, statt sie selbst zu tragen. Seine Lippen waren nicht so verkniffen, sein Ausdruck nicht so düster. Er hat sich nicht eine Frau nach der nächsten aufgerissen, um sich weniger beschissen zu fühlen. Er hat das gar nicht gebraucht.
Manchmal vermisse ich ihn, obwohl er direkt neben mir sitzt. So auch jetzt. Trotzdem werde ich niemals von seiner Seite weichen. Dieses Versprechen habe ich ihm gegeben. Er hat es zwar nicht gehört, aber das macht es nicht weniger gültig und meine Entschlossenheit, es einzuhalten, nicht weniger unbeugsam.
»Mal im Ernst«, setzt diesmal Johann an. »Heute bist du echt nicht ganz da, Jordan.«
»Ich habe viel zu tun«, rede ich mich raus. »Ich gehe schon mal in Gedanken all die Dinge durch, die ich am Nachmittag erledigen muss.« Ich werfe einen Blick auf meine Uhr, ohne zu lesen, welche Zeit mir angezeigt wird. »Leider muss ich auch schon los.« Ein bisschen zu abrupt erhebe ich mich und bringe den Tisch damit zum Wackeln, aber da nichts umfällt, kommentieren meine Freunde es nicht. »Wir sehen uns dann am Wochenende.«
»Wir sehen uns morgen«, ruft Lorena mir nach, da habe ich mich schon von ihnen abgewandt. »Zur Mittagspause. Wie immer.«
Ich winke nur, drehe mich nicht noch einmal um und laufe mit zügigen Schritten zurück zum Kaufhaus. Wie ich eine weitere Stunde mit Johann und Lorena überleben soll, während dieses riesige Geheimnis über mir schwebt, weiß ich nicht. Aber wie ich mich rausreden soll, ohne dass sie Verdacht schöpfen, weiß ich auch nicht.
Seit Matt und ich im Kaufhaus arbeiten, ist die gemeinsame Mittagspause unser tägliches Ritual. Johann wird bald offiziell in das Familienunternehmen der Kronenbergers einsteigen und ist somit auch den ganzen Tag dort. Lorena kommt immer extra aus der Uni, um mit uns zu essen.
Ich glaube, wir alle klammern uns so verzweifelt an diese gemeinsame Zeit, um uns wieder normal zu fühlen, so, wie wir früher waren. Weil wir dann wenigstens kurz vergessen können, dass zwei Personen in unserer Runde fehlen – und eine nie zurückkehren kann und eine nicht zurückkehren will.
Mein Atem geht ruckartig durch meinen Körper, während ich durch die belebten Straßen laufe, ohne meine Umgebung richtig wahrzunehmen. Doch das muss ich auch nicht, weil ich diese Strecke auch im Schlaf laufen könnte.
Als ich den Eingang des Kaufhauses erreiche, erstarre ich. Meine Gedanken an sie waren wohl so stark, dass sie sie heraufbeschworen haben. Wieder steht Juli Forster vor dem Kaufhaus. Diesmal hat sie ihm aber den Rücken zugewandt und mustert nicht die Fassade, sondern betrachtet die Straße.
Sie wirkt wieder angespannt, fast schon verzweifelt. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, warum ich sie vorhin angesprochen habe, bevor ich wusste, wer sie war. Ich glaube, die intensive Ausstrahlung, die von ihr ausgeht, hat mich auf sie zu gezogen und bringt mich auch jetzt wieder dazu, auf sie zuzugehen
»Kann man dir helfen?«, frage ich sie erneut.
Wieder zuckt sie zusammen, als sie mich hört. Langsam dreht sie sich zu mir um. »Dir ist wohl keine bessere Frage eingefallen«, sagt sie trocken.
Ein Grinsen zieht an meinen Mundwinkeln. »Das kann sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich zu dem sagen soll, was ich vorhin im Büro erfahren habe.«
Ihre Haare werden vom nächsten Windstoß aufgescheucht. Die blonden Strähnen mit den knallpinken Spitzen legen sich über ihr Gesicht, können ihre strahlend blauen Augen aber nicht verbergen. Juli schiebt sie sich hinter die Ohren. Ihre Haare sind so kurz, dass sie nicht einmal ihre Schultern berühren.
»Am besten gar nichts«, meint sie.
»Okay.« Ich nicke. »Worauf wartest du?«
»Was meinst du?«
»Du stehst hier. Du wirkst, als würdest du auf etwas warten.«
Sie schnaubt. Ich würde denken, dass es belustigt klingt, wenn ihr Gesichtsausdruck nicht noch immer so starr wäre. »Ich warte auf nichts. Ich bin einfach …«
Sie beendet den Satz nicht, und ich werde nicht nachhaken.
»Soll ich dich nach Hause fahren?«, biete ich ihr stattdessen an.
Erstaunt sieht sie mich an. »Wieso solltest du das tun?«
Gute Frage, denke ich. »Weil ich nett bin?«, schlage ich vor.
»Das kaufe ich dir nicht ab«, erwidert sie.
Ich mir auch nicht, aber darum geht es gerade nicht. Das rede ich mir zumindest ein. »Wir haben uns ja geeinigt, dass wir nicht darauf eingehen werden, was ich vorhin erfahren habe.«
»Richtig«, sagt sie mit Nachdruck.
»Aber, obwohl wir darüber nicht reden werden, deute ich hiermit an, dass ich mir vorstellen kann, dass ein anstrengendes Gespräch stattgefunden hat, nachdem ich gegangen bin. Und nach so einem anstrengenden Gespräch will man vielleicht nicht darüber nachdenken, wie man nach Hause kommt.«
In ihren Gesichtszügen liegt definitiv eine Emotion. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche.
»Und natürlich will ich nicht, dass du vor ein Auto läufst, weil du mit deinen Gedanken woanders bist.« Dass auch meine Gedanken mich immer wieder fortgetragen haben und unweigerlich bei ihr gelandet sind, denke ich mir, sage ich aber nicht.
»Natürlich willst du das nicht«, kommentiert sie. Dann seufzt sie schwer. »Ich habe keine Energie, mit dir zu diskutieren.«
Das ist wohl ihre Art, sich bei mir für meine Hilfsbereitschaft zu bedanken. Doch statt mich zu beschweren, grinse ich nur und bedeute ihr, mir zu folgen. Ich steuere den Eingang ins Parkhaus an, der nicht durchs Kaufhaus führt. Ich habe das Gefühl, dass sie diesen Ort gerade nicht noch mal betreten will.
Wir laufen schweigend an den endlos erscheinenden Reihen an Autos vorbei, bis wir schließlich meines erreichen. Sie zieht die Augenbrauen nach oben, sagt aber nichts. Als ich das Auto entsperre, steigt sie einfach ein. Ich tue es ihr gleich.
Wir schweigen auch noch, da haben wir das Parkhaus schon wieder verlassen. Nur, um mir mitzuteilen, wo ich langfahren soll, spricht sie mit mir. Sie starrt durch das Fenster auf der Beifahrerseite. Ich kann körperlich spüren, dass viel in ihr vorgeht. Ihre Gedanken sind so laut, dass ich glaube, ihr Echo hören zu können.
»Was wolltest du vorhin sagen, als du mein Auto gesehen hast?«, frage ich unvermittelt. Einerseits, weil das Schweigen ein bisschen unangenehm ist. Andererseits, weil ich sie von dem ablenken will, was gerade in ihr vorgeht.
»Ich wollte nichts sagen«, entgegnet sie verspätet.
»Deine nach oben gezogenen Augenbrauen haben etwas anderes behauptet.«
Sie schnaubt. Diesmal klingt es eindeutig belustigt. »Ich habe mich nur erneut gefragt, was für eine Art Assistent du bist.«
»Ein ganz normaler«, erwidere ich ein bisschen überfordert.
»Ganz sicher nicht«, hält sie dagegen und wendet sich mir das erste Mal, seitdem wir ins Auto gestiegen sind, zu. »Du trägst einen maßgeschneiderten Anzug, eine extrem teure Uhr und fährst einen Mercedes. Das kann man sich mit einem Assistentengehalt ganz sicher nicht leisten.«
»Okay, vielleicht bin ich kein ganz gewöhnlicher Assistent«, wende ich ein.
Kurz ist ihr Körper nicht mehr so verkrampft, also finde ich es in Ordnung, dass sie mich so ansieht, als wollte sie mich einem Kreuzverhör unterziehen.
»Dachte ich mir«, meint sie. »Aber ich weiß nicht, was du sonst bist.«
Sie sagt mir, wo ich abbiegen soll, das gibt mir einen Moment, um über meine Antwort nachzudenken.
»Meine Eltern sind eng mit den Kronenbergers befreundet, und schon vor Jahren haben sie sich darauf geeinigt, dass ihre Kinder bei der jeweils anderen Familie Erfahrungen im Betrieb sammeln sollen, bevor sie ins eigene Unternehmen einsteigen. Deswegen arbeiten mein Bruder und ich für ein Jahr im Kaufhaus. Er ist der Assistent von Richard Kronenberger und ich von Joachim Kronenberger.«
Juli runzelt die Stirn. »Welches Unternehmen führen deine Eltern?«
»Hotels«, sage ich vage.
Kurz bleibt sie still, während es in ihr zu arbeiten scheint. Dann weiten sich ihre Augen. »Die Jordan Hotels.«
Ich nicke nur.
»Du bist der Erbe der Jordan Hotels?«, stößt sie ungläubig aus. »Der Luxushotel-Kette?« Sie schüttelt den Kopf. »Ein ganz normaler Assistent. Dass ich nicht lache.«
»Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich fast denken, du verurteilst den Kerl, der so freundlich war, dich nach Hause zu fahren und dich nicht auf das Thema anzusprechen, über das du nicht reden willst.«
Juli verschränkt die Arme vor der Brust. »Zum Glück weißt du es ja besser.«
Ich verstehe mich selbst nicht, aber ihre trockenen Kommentare bringen mich zum Grinsen, statt mich aufzuregen.
»Zum Glück«, wiederhole ich nur und biege in die nächste Straße.
»Das heißt, du kennst … die Kronenbergers gut«, setzt sie unsicher an. Fast so, als hätte sie diesen Satz am liebsten gar nicht gesagt.
»Ja«, entgegne ich schlicht, weil ich ihr nicht mehr verraten will, als sie eigentlich hören möchte.
»Okay«, meint sie nur, und ihr harter Tonfall gibt mir zu verstehen, dass das Gespräch hiermit beendet ist.
Ich komme ihrer stummen Aufforderung nach. Die restliche Strecke verbringen wir abgesehen von ihrer Navigation wortlos.
Wieder geht diese intensive Ausstrahlung von ihr aus, der man sich nicht entziehen kann. Ich glaube, dass sie aus all den Dingen besteht, die sie nicht laut sagt. Ich kenne die Macht, die ungesagte Worte über einen haben können.
»Hier«, sagt sie schließlich, und ich halte am Straßenrand.
Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass sie sofort aus dem Auto springen wird, sobald sich ihr die Möglichkeit bietet. Doch sie bleibt sitzen.
»Danke, dass du mich gefahren hast«, murmelt sie in sich hinein, ohne mich anzusehen. »Ich wäre vermutlich wirklich vor irgendein Auto gelaufen.«
Ich lächle matt. »Keine Ursache.«
Sie wendet sich mir noch einmal zu. Ihr Blick ist unlesbar. Ihre Haltung wäre es auch, wenn sie nicht vor unterdrückter Spannung beben würde. Ich bilde mir ein, dass ein statisches Geräusch von ihr ausgeht und mein ganzes Auto ausfüllt.
»Bye«, sagt sie.
»Bye«, erwidere ich.
Doch noch immer steigt sie nicht aus. Ihre Augen fixieren einen Punkt. Aber nicht in meinem Gesicht, sondern an meiner Hand. Dann streckt sie ihre aus, und ihr Zeigefinger berührt meine Haut. Nur flüchtig. Nur für den Bruchteil einer Sekunde. Federleicht. Und trotzdem hinterlässt sie einen Abdruck. Bevor ich realisiere, was passiert ist, hat sie die Autotür schon wieder hinter sich zugeschlagen und läuft zielstrebig auf ein Wohnhaus zu.
Ich sollte zurück zum Kaufhaus fahren, aber ich kann nicht. Reglos sitze ich in meinem Auto und starre auf meine Hand. Auf die Stelle, die sie berührt hat. Dort ist ein winzig kleiner blauer Farbklecks, der mir den ganzen Tag nicht aufgefallen ist. Aber sie hat ihn entdeckt.
Mein Herz schlägt so heftig, dass es in meinen Ohren dröhnt.
Sie hat gesehen, was ich sonst so vorbildlich verstecke.
Ich mag heute ihr größtes Geheimnis erfahren haben, aber ob es ihr bewusst ist oder nicht – sie hat auch meins gelüftet.
3. Kapitel
JULI
Die Kuppe meines Zeigefingers kribbelt. Vermutlich, weil er mir mitteilen will, wie seltsam ich bin. Danke. Das muss man mir nicht sagen. Das weiß ich auch so.
Ich schüttle den Kopf über mich selbst, während ich im Hauseingang stehe und versuche, zu mir zu kommen, damit ich bereit bin, meine WG zu betreten. Ich warte darauf, dass sich mein Puls beruhigt. Aber darauf kann ich wohl bis in alle Ewigkeit warten.
Ich habe seine Hand berührt. Welche Sicherung ist mir heute eigentlich rausgesprungen? Bestimmt gleich mehrere.
Als ich ein Seufzen ausstoße, lasse ich meinen Kopf in den Nacken fallen und starre an die Decke, auf der ein riesiger Wasserfleck prangt.
Der kleine blaue Farbklecks an seiner rechten Hand hat mich quasi magisch angezogen. Ich konnte meinen Arm nicht daran hindern, sich danach auszustrecken. Farbe ist immer das gewesen, woran ich mich festgehalten habe. Deswegen musste ich diesen kleinen Fleck einfach berühren. Es war das einzig Vertraute in einem Auto, das mir fremd war, an einer Person, die für all das steht, was mir mein ganzes Leben vorenthalten war.
Ich schüttle meine Hände aus, in der Hoffnung, dass das Kribbeln dann endlich von mir ablässt. Ich kann nicht schon zum zweiten Mal am selben Tag an einer Stelle festwachsen, nur weil ich mich nicht traue, weiterzugehen. Wenn man als Kleinkind laufen lernt, ist einem noch gar nicht bewusst, dass die wahren Hindernisse nicht die sind, die man sehen kann.
Einen Moment gestatte ich mir noch, tief Luft zu holen. Dann zwinge ich mich weiterzulaufen. Die Holzstufen, die eingedellt sind, weil über die Jahre zu viele Menschen über sie gelaufen sind, knarzen unter meinen Füßen, als ich sie zügig erklimme. Ich liebe dieses Haus mit den hohen Decken und dem abbröckelnden Stuck und dem wackeligen Geländer. Aber jedes Mal, wenn ich in den fünften Stock in meine Wohnung laufe, hasse ich es auch ein bisschen. Ein Fahrstuhl würde mein Leben definitiv erleichtern.
Schon mehrere Sekunden, bevor ich die Person sehe, höre ich, dass mir jemand entgegenkommt.
»Milo«, entfährt es mir, als ich ihn erkenne. Nur wenige Zentimeter vor mir kommt er zum Stehen. Hätte ich nicht auf mich aufmerksam gemacht, hätte er mich umgerannt. Und da ich nur ein Meter zweiundsechzig groß bin und er über ein Meter neunzig, wäre dieser Zusammenstoß nicht gut für mich ausgegangen.
»Sorry, Juli. Habe dich gar nicht gesehen«, murmelt er in sich hinein und will sich schon an mir vorbeischieben. Doch ich blockiere ihm wieder den Weg.
»Was ist los?« Ich kenne Milo lang genug, um zu erkennen, wenn es ihm nicht gut geht.
»Ach nichts.« Er kann meinen Blick noch immer nicht erwidern. Obwohl seine Haltung in sich zusammengesunken ist, überragt er mich noch immer um einen ganzen Kopf.
»Bullshit«, sage ich trocken, was ihm tatsächlich ein kleines Lachen entlockt.
»Ich will nicht darüber reden«, meint er schließlich.
»Dann werde ich nicht weiter fragen. Aber wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du mich immer anrufen.«
Wir wissen beide, dass er das nicht tun wird, aber manchmal hoffe ich, ihm mit diesem Angebot wenigstens ein bisschen Trost spenden zu können.
»Danke«, sagt er und schaut mich kurz an. »Wir sehen uns.«
Er drückt kurz meine Schulter, dann läuft er auch schon an mir vorbei und poltert weiter die Treppe hinunter.
»Sag deinem Vater und deinen Geschwistern liebe Grüße von mir«, rufe ich ihm hinterher.
»Mache ich.« Eine Sekunde später höre ich auch schon, wie die Haustür hinter ihm wieder ins Schloss fällt.
Ich erklimme das letzte Stockwerk, und noch bevor ich die WG betreten habe, dringen aufgeregte Stimmen an meine Ohren.
Ein letztes Seufzen stoße ich aus, dann schließe ich die Tür auf.
Jeder, der zum ersten Mal hier ist, stellt fest, dass er noch nie in einer Wohnung war, die so seltsam geschnitten ist wie diese. Sobald man die Tür öffnet, steht man bereits in der Wohnküche. Die Küchenzeile ist in eine Ecke gequetscht. Sollte man versuchen zu kochen, stößt man sich den Kopf an der Dachschräge, wenn man nur ein bisschen größer als ich ist. Ein rosa Sofa mit Oma-Blümchenmuster steht vor einem tiefen Fenster, das schon seit Jahren nicht mehr aufgeht. Dahinter führt der Flur entlang, der einen scharfen Knick um die Ecke macht. Von hier bis zum Bad braucht man fast zwanzig Sekunden. Der Weg kommt einem mitten in der Nacht ewig vor. Vier Zimmer gehen vom Flur ab. Doch deren Aufteilung hilft auch nicht, um zu erklären, warum der Flur einen Knick macht. Aber keiner von uns hat je einen Grundriss der Wohnung gesehen, also werden wir sie wohl nie verstehen.
Meine drei Mitbewohner befinden sich gerade in der Wohnküche. Hanna hockt mit angezogenen Beinen auf dem Sofa und wippt langsam vor und zurück. Liv und Jakob sitzen auf den Klappstühlen an unserem runden Esstisch mit der Plastikdecke, die wir gekauft haben, weil mindestens einmal am Tag einer von uns Kaffee verschüttet und wir die Stofftischdecken zu oft waschen mussten.
»Also hast du es nicht gesagt, weil du es nicht fühlst oder weil du dich nicht getraut hast?«, fragt Liv gerade. Jakob schnauft nur. Sie wirft ihm einen wütenden Blick über die Schulter zu und widmet sich wieder Hanna.
»Besteht da überhaupt ein Unterschied?«, fragt sie. Ihr Pony ist wieder ein bisschen zu lang geworden, und sie blinzelt ständig, weil ihr einzelne Strähnen in die Augen hängen. Ich muss es ihr echt bald mal wieder nachschneiden.
»Ein riesiger!«, stößt Liv aus und wirft dabei auch noch ihre Arme in die Höhe. Jakob schnaubt wieder. Diesmal ignoriert sie ihn einfach.
Meine Freunde begrüßen mich nicht, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr mit Begrüßungsfloskeln auf. Und wenn meine Freunde hitzig miteinander diskutieren, hört die Welt um sie herum sowieso auf zu existieren.
Ich fühle mich emotional so ausgelaugt, dass ich bestimmt zwei Tage lang schlafen könnte. Eigentlich brauche ich Ruhe. Doch ich schaffe es auch nicht, in mein Zimmer zu gehen. Ich will nicht reden, aber ich will auch nicht allein sein. Also kicke ich nur meine weißen Sneakers von meinen Füßen, schmeiße meine Tasche obendrauf, hänge meinen Mantel an die Garderobe und laufe zum Sofa. Ich setze mich neben Hanna, die mir ein schmales Lächeln schenkt, bevor sie wieder Liv ansieht.
»Aber ich habe es nicht gesagt. Warum ich das getan habe, ändert auch nichts am Resultat. Zumindest nicht für Milo.«
Ich lege meinen Nacken auf der Rückenlehne ab und schaue wieder zur Decke. An unserer prangt zwar kein Wasserfleck, aber an einer kleinen Verfärbung kann man immer noch erkennen, wo der Korken gelandet ist, als Liv zu enthusiastisch eine Sektflasche geöffnet hat, um auf mein bestandenes Abi anzustoßen. Nur den drei Menschen in diesem Raum habe ich es zu verdanken, dass ich die Prüfungen bestanden habe. Nach dem Tod meiner Mutter haben sie mich emotional und finanziell unterstützt. Sie haben gearbeitet, damit ich es nicht musste und mich aufs Lernen konzentrieren konnte. Sie waren in meinen dunkelsten Stunden für mich da. Sie würden alles für mich tun und ich alles für sie. Und das ist der Grund, warum ich heute eine Entscheidung getroffen habe, die ich ganz sicher in naher Zukunft bereuen werde.
»Also seid ihr jetzt nicht mehr zusammen?«, meldet sich Jakob das erste Mal, seit ich zurückgekommen bin, zu Wort. Er klingt bemüht gleichgültig, aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass ihm die Antwort auf seine Frage alles andere als gleichgültig ist.
Hanna nickt. »Richtig. Wir sind nicht mehr zusammen.«
»Aber nur für die nächsten drei Sekunden«, kommentiert Liv.
»Diesmal ist es endgültig«, meint Hanna.
»Das glaubst du doch selbst nicht«, erwidert Liv. »Wie oft habt ihr euch im letzten Jahr getrennt und wie oft hast du uns versichert, es wäre das letzte Mal …« Hanna setzt an, doch Liv wird einfach nur ein bisschen lauter und spricht ungerührt weiter. »Und wie oft seid ihr dann doch wieder zusammengekommen.«
Hanna straft sie mit einem bösen Blick, aber ihr scheint gerade keine gute Entgegnung einzufallen. Liv hat schließlich recht. So funktioniert die dysfunktionale Beziehung von Milo und Hanna. Sie machen Schluss, weil Hanna nicht in der Lage ist, eine richtige Beziehung zu führen, und Milo genau das von ihr will. Doch letztendlich kommt er jedes Mal zurück. Aus einem ganz einfachen Grund: Er liebt sie. Aber sobald sie wieder zusammen sind, steuern sie erneut unweigerlich auf eine Trennung zu. Ebenfalls aus einem ganz einfachen Grund: Sie liebt ihn nicht.
Aber ich werde Hannas Liebesleben sicherlich nicht kommentieren. Ich war noch nicht einmal lang genug mit einem Kerl zusammen, um eine On-off-Beziehung führen zu können. Deswegen glaube ich, dass es besser ist, wenn ich keine Ratschläge von mir gebe.
»Dieser Tag hätte so anders aussehen sollen«, stößt Hanna gequält aus.
Das kann ich nur bestätigen. Wir haben uns heute alle einen freien Tag von der Arbeit genommen, weil wir gemeinsam etwas unternehmen wollten. Hanna hat die Gitarrenstunden an der Musikschule an ihre Kollegen abgetreten, Jakob musste lange mit seinem Chef diskutieren, damit er heute nicht in die Schreinerwerkstatt kommen musste. Ich habe eine Strafpredigt meiner Chefin in Kauf genommen, und Liv schwänzt die Berufsschule. Sie behauptet, dass sie da ohnehin nichts lernt, was sie sich nicht selbst beibringen kann. Einzelhandelskauffrau ist ihr zufolge ein Job, den man sich Learning by Doing beibringt.
Obwohl wir keinen großen Ausflug machen, sondern uns einfach etwas Essen einpacken und in irgendeinen Park gehen wollten, habe ich mich sehr auf diesen Tag gefreut. Aber alle Pläne wurden vereitelt, als heute Morgen um acht Uhr der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und eine Abfolge von Ereignissen angestoßen hat, die ich immer noch nicht ganz verstehe.
»Du meinst, du wolltest Milo heute nicht wieder das Herz brechen?«, fragt Liv zuckersüß nach.
»Ich kann so eine Unterhaltung nicht an einem Tag führen, an dem ich nicht einmal duschen konnte«, wehrt Hanna ab.
»Du hättest duschen können«, meint Jakob.
»Kalt.« Hanna schüttelt sich. »Und ich dusche nicht kalt.«
»Wenn wir das Geld für die Stromrechnung nicht auftreiben, wird dir bald nichts a...