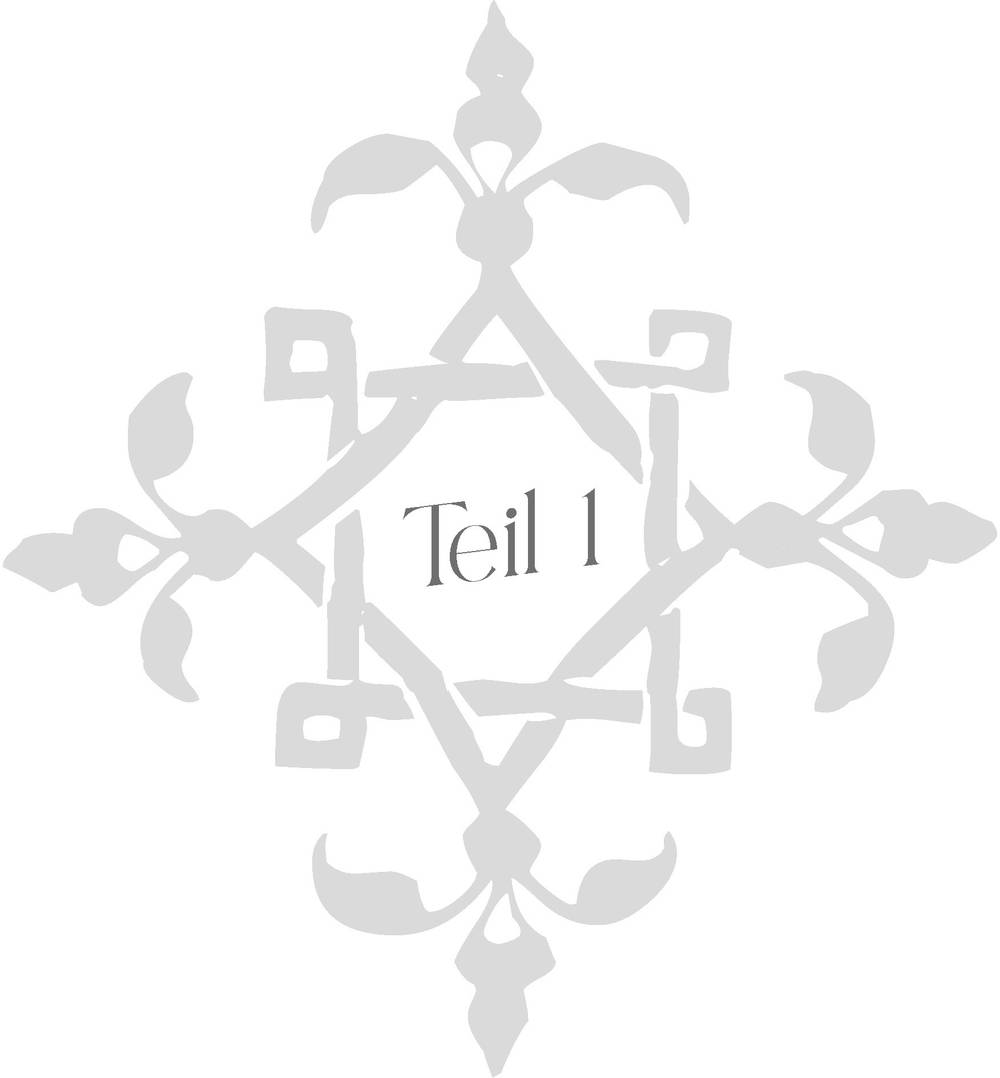Die Geliebte des Räubers
Wem traust du, wenn dein Herz verraten wird?
Deutschland 1802. Die Gebiete links vom Rhein sind gerade erst an Frankreich gefallen und stehen fortan unter französischer Verwaltung. Das bringt für die Bevölkerung neue Pflichten, aber auch neue Rechte. Diese Zeit des Umbruchs ermöglichte es einer Vielzahl von Kriminellen, sich zu Räuberbanden zusammenzuschließen und Land und Leute mit rücksichtsloser Brutalität auszuplündern. Der jungen Lisbeth sind seit einem Überfall auf ihre Eltern die räuberischen Banden verhasst. Als ihr Dorf von Räubern terrorisiert wird, wehrt sich die selbstständige Näherin mit allen Mitteln, über die sie als Frau verfügt, um die Eindringlinge gegeneinander auszuspielen und das Dorf zu befreien. Doch auf welcher Seite steht der Dorfbüttel Johann, der Mann, den sie liebt, und von dem keiner so genau weiß, wer er ist und woher er eigentlich kommt?