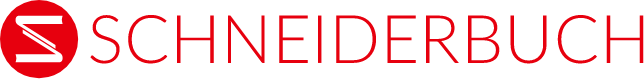Das Zeitalter des magischen Zerdenkens. Notizen zur modernen Irrationalität
Sinn, wo steckst du? – Warum wir über die falschen Dinge zu viel nachdenken
Jede Generation hat ihre eigene Krise. Um die Last des Informationszeitalters zu bewältigen, riskiert unser Verstand so manches Ausweichmanöver: Wir lassen uns von Online-Astrologen in Jobfragen beraten, vergöttern (oder verdammen) Taylor Swift, als sei sie unsere eigene Mutter, klicken uns paranoid durch Insta-Profile und bringen unser Weltbild durch Algorithmen ins Wanken.
Voller Klugheit und Komik schreibt Amanda Montell von den tief verwurzelten Verzerrungen,
die in unseren Köpfen grassieren, und verwebt dabei ihre eigenen Erfahrungen mit akuter Kulturkritik: Wir katastrophieren, dramatisieren, verschwören, beschönigen und unken und verwechseln dabei gerne Ursache und Wirkung. Selten hat man sich in seinen verzerrten Wahrnehmungen so ertappt gefühlt.
Ihr Buch ist Augenöffner und Beruhigungsmittel zugleich, denn je besser wir unsere Irrationalitäten verstehen, umso vernünftiger (und versöhnlicher) uns selbst gegenüber können wir damit umgehen.
»Montell geht der Frage nach, wie das Internet und das ständige Online-Sein uns in ängstliche, irrationale Wesen verwandelt haben, die alles chronisch überdenken müssen. Und natürlich schenkt sie uns auch eine Pause vom Chaos unseres modernen Zeitalters.«
Men’s Health
»Wer schon einmal in seinem eigenen Kopf gefangen war, kann in Amanda Montells neuestem Werk Trost finden. Es ist eine reizvolle Mischung aus Kulturkritik und persönlicher Erzählung, die dem modernen Informationszeitalter, den überlasteten Bewältigungsmechanismen unseres Gehirns und der Irrationalität der Gesellschaft auf den Grund geht.«
NYLON
»Montell führt ihre Fans auf die vielen Straßen, auf denen sich das Wettrennen zwischen Sprache, Psychologie und ihren eigenen bizarren Verhaltensweisen verfolgen lässt.«
Elle