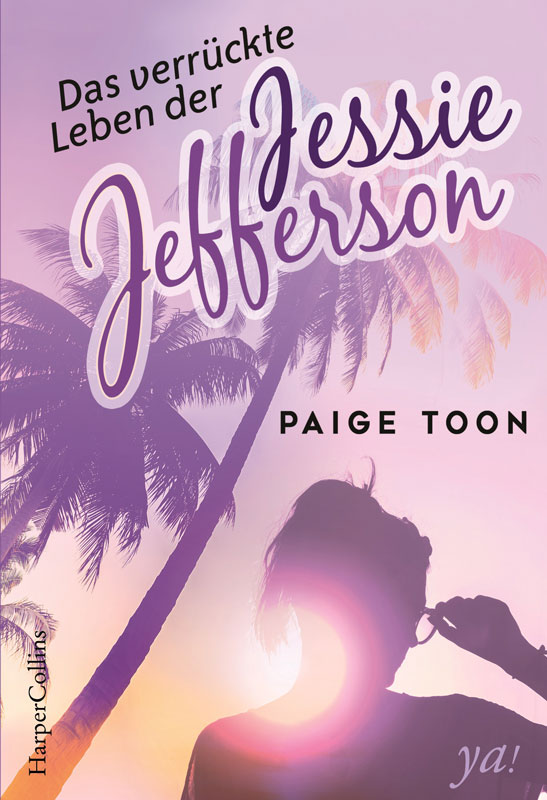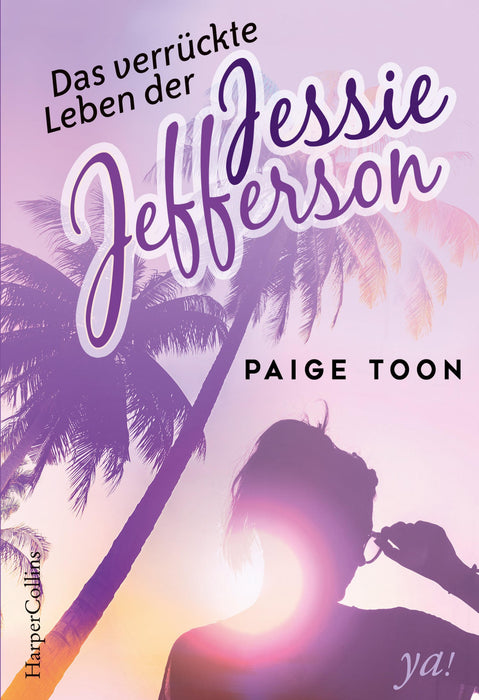
Das verrückte Leben der Jessie Jefferson
An Jessies 15. Geburtstag verunglückt ihre Mutter tödlich - ohne je verraten zu haben, wer ihr leiblicher Vater ist. Außer sich vor Trauer und Wut, entlockt Jessie ihrem Stiefvater das schockierende Geheimnis: Ihr Erzeuger ist der Mega-Rockstar Johnny Jefferson, der nichts von ihrer Existenz ahnt! Klar, dass Jessie ihren berühmten Dad unbedingt treffen will, doch der Besuch im sonnigen Kalifornien, wo Johnny mit seiner Familie lebt, verläuft zunächst holprig. Dank des heißen Nachwuchsmusikers Jack findet Jessie schließlich Gefallen an der Glitzerwelt von L.A. Aber kann sie in dieser Glamourwelt wirklich bestehen?
"Wundervoll und clever. Macht süchtig nach mehr!"
Cosmopolitan
"Überraschend und aufregend - und gleichzeitig süß und romantisch!"
Heat
"Einfach unwiderstehlich"
Company
"Witzig und fesselnd - die perfekte Urlaubslektüre!"
Closer
"Es ist großartig, wieder von Johnny und Meg zu hören - aus der Perspektive seiner Tochter Jessie."
Leserstimme auf Goodreads