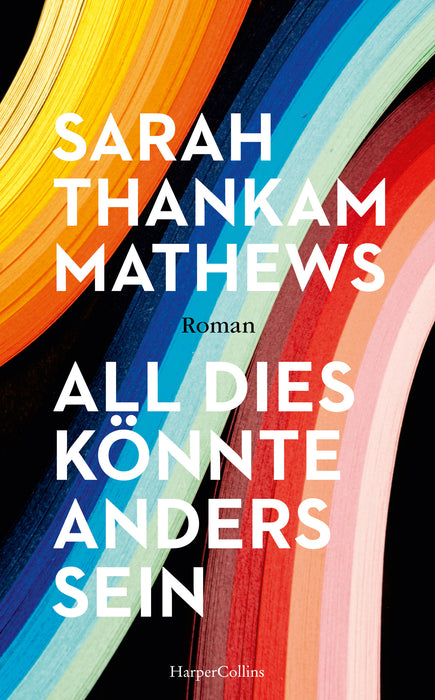
All dies könnte anders sein
»Eines der aufregendsten Bücher des Jahres.« Vogue
Etwas muss sich ändern, aber was wenn die ganze Welt gegen einen scheint?
Snehas Abschluss fällt in den Schlund der amerikanischen Rezession, und doch gehört sie zu den Glücklichen. Für ihre erste Stelle zieht sie nach Milwaukee; und obwohl der Job aufreibend ist, eröffnet er ihr unverhoffte Möglichkeiten: Sie kann die Drinks ihrer neuen Freunde bezahlen und ihren Eltern in Indien Geld schicken. Sneha stürzt sich auch ins Dating und verknallt sich bald in die Tänzerin Marina. Doch der Druck ist groß, und bald zeigt sich, dass dieses gute neue Leben auf wackeligen Beinen steht. Sneha braucht Hilfe – aber sie durfte nie lernen, sich verletzlich zu zeigen.
Sarah Thankam Mathews spricht einer ganzen Generation aus der Seele, die lernt Gemeinschaften zu schmieden, um in einer rücksichtslosen Welt ihr Zuhause zu finden.
»Das ist ein ganz großes, intensives Buch über eine riesige Lebenskrise. […] [das] hat so einen großen Sog und macht so Spaß, weil es ein Lebensgefühl trifft.« Stefan Mesch, Dlf Kultur
»All dies könnte anders sein ist ein außergewöhnlicher Roman: stachlig und zart, witzig und unglaublich bewegend. Sarah Thankam Mathews ist eine geniale Autorin und jeder ihrer Sätze hat sowohl Biss als auch Herz.« Lauren Groff
»Fängt die heimtückischen, unsagbaren Seiten der Sehnsucht und den langen Schatten der Familie ein.« Raven Leilani
»Der Treibstoff dieses Romans ist die Liebe, eine Kraft, die Mathews nicht als Allheilmittel, sondern als Instrument der Veränderung zeichnet.« The New Yorker

