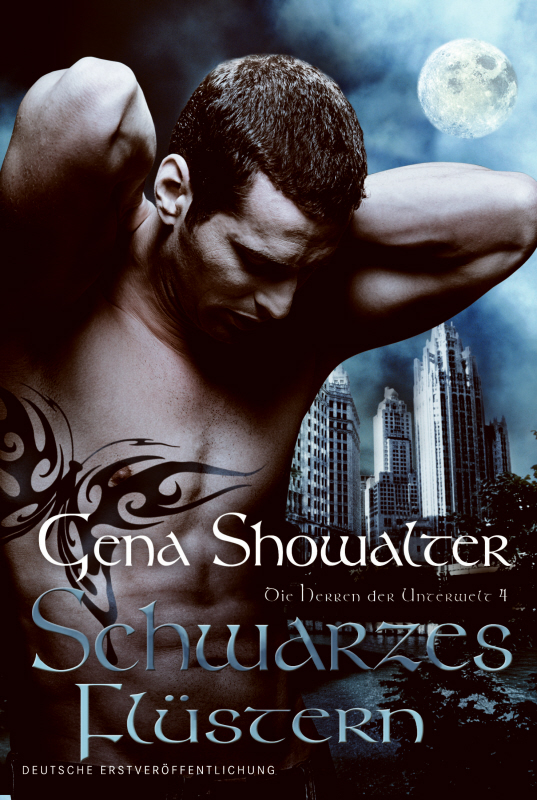Die Herren der Unterwelt - Teil 4-6 (3in1)
SCHWARZES FLÜSTERN
Sabin ist der Träger des Zweifels. Der Liebe hat er abgeschworen, seit sein Dämon die letzte Frau, die Sabin begehrte, vor Jahren regelrecht in den Tod getrieben hat. Seither kämpft er nur noch an der Seite der anderen Lords gegen die Jäger, Sterbliche, die die Dämonen bannen und die Lords danach töten wollen.
Auf einem der Feldzüge gegen die Jäger lernt Sabin in Ägypten jedoch Gwen kennen. Ihr, die halb Harpyie und halb Engel ist und demnach eine dunkle und eine helle Seite in sich vereint, kann der vom Zweifel gepeinigte Herr der Unterwelt nicht widerstehen. Doch gelingt es der Halbtochter Luzifers, ihre zerstörerische Kraft zu bannen? Und kann sie darüber hinaus den Dämon des Zweifels in Sabin zum Schweigen bringen?
SCHWARZE LEIDENSCHAFT
Sie trug keine Schuhe, und als sie mit nackten Füßen über einen Stein stolperte und hinfiel, ergoss sich das dunkle Haar über ihr Gesicht. Ihre Hände zitterten, als sie sich eine Strähne aus der Stirn strich.
Schon seit längerem fühlt sich Aeron von einer unsichtbaren Macht beobachtet. Der unsterbliche Krieger und Hüter des Zorn-Dämons fürchtet, es könnte sich um einen gefallenen Engel handeln - gesandt, um ihn zu töten. Umso verwirrter ist Aeron, als plötzlich eine wunderschöne Frau aus Fleisch und Blut vor ihm steht. Olivia offenbart ihm, dass sie dem Himmel entsagt und das Leben einer Sterblichen gewählt hat, weil sie nicht ihn umbringen, sondern sein Herz für sich gewinnen möchte.
SCHWARZE LÜGEN
Er darf alles, nur eins ist ihm bei Todesqualen verboten: die Wahrheit zu sagen. Gideon ist der fünfte Herr der Unterwelt, und in ihm haust der Dämon der Lüge.
Und so wie er selbst Wahres nicht benennen darf, so erkennt er bei anderen sofort die Lüge. Bis er auf Scarlet trifft, eine ebenfalls unsterbliche Seele. Sie behauptet, seine Frau zu sein: der Mensch, den er einst geheiratet und leidenschaftlich geliebt hat. Doch so wenig Gideon sich erinnern kann, so wenig deutet darauf hin, dass Scarlet lügt.
Im Gegenteil: In ihrer Gegenwart flammt in Gideon ein längst vergessenes Verlangen neu auf. Doch er darf ihm nicht nachgeben, denn damit würde er Scarlet in tödliche Gefahr bringen …