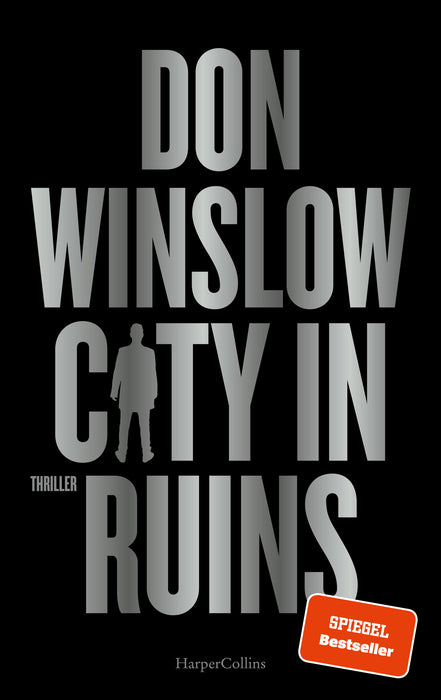
City in Ruins
Das fulminante Finale der Thriller-Trilogie und das letzte Buch des Ausnahme-Autors Don Winslow
Danny Ryan ist reich. Reicher, als er es sich je erträumt hätte. Früher war er ein Hafenarbeiter, Mafia-Gang-Mitglied und Gesetzesflüchtling, nun ist Danny ein erfolgreicher Geschäftsmann in Las Vegas. Doch er will mehr.
Als er versucht, ein altes Hotel auf einem erstklassigen Grundstück zu kaufen, löst er einen Krieg zwischen den mächtigsten Männern in Vegas aus. Danny glaubt, seine Vergangenheit begraben zu haben, doch nun droht sie ihn einzuholen. Alte Feinde kehren zurück – mit dem Ziel, ihm alles zu nehmen, was ihm wichtig ist: nicht nur sein Imperium, nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Sohn.
Um zu retten, was Danny am meisten liebt, muss er wieder der skrupellose Mann werden, der er einst war – und der er nie wieder sein wollte ...
Das letzte Buch des großen Thriller-Autors ist ein epischer Kriminalroman über Liebe und Hass, Ehrgeiz und Verzweiflung, Rache und Mitgefühl, der von den Machtkorridoren von Washington, D. C., über die Wall Street bis hin zu den goldenen Casinos von Las Vegas reicht.

