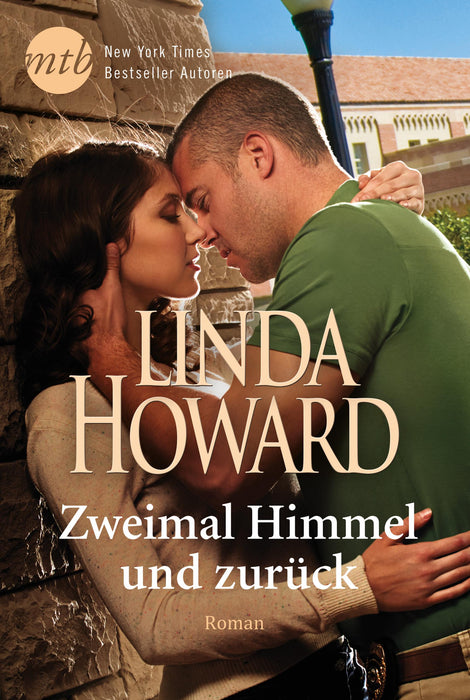
Zweimal Himmel und zurück
Wie konnte sie sich von Johns Küssen verführen lassen? Jetzt wird ein Mordanschlag auf John verübt, und Michelle ahnt, wer dahintersteckt - ihr brutaler Ex. Wird sie ihm je entkommen können?
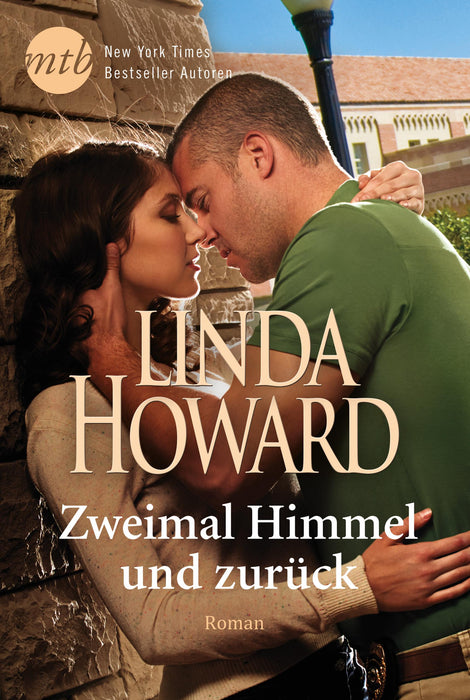
Wie konnte sie sich von Johns Küssen verführen lassen? Jetzt wird ein Mordanschlag auf John verübt, und Michelle ahnt, wer dahintersteckt - ihr brutaler Ex. Wird sie ihm je entkommen können?
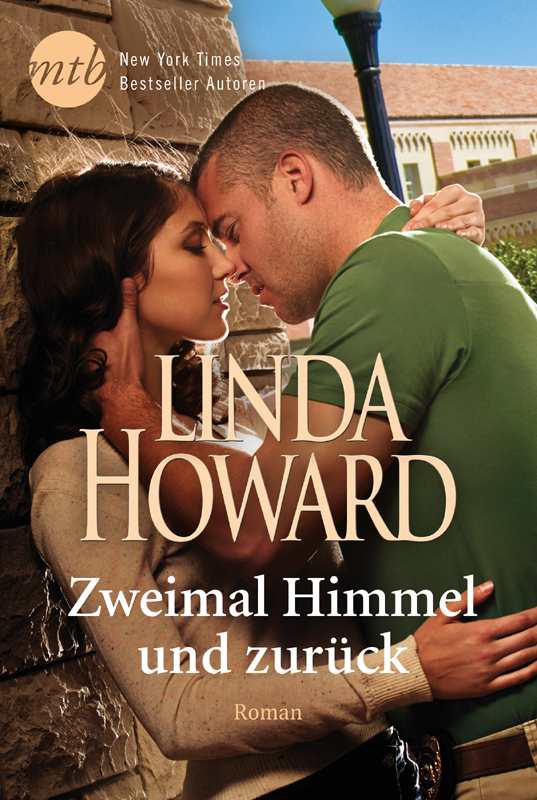
Sie fand das Papier, während sie die persönlichen Dinge im Schreibtisch ihres Vaters durchsah. Michelle Cabot faltete das Blatt auseinander und überflog es mit genauso beiläufiger Neugier wie zuvor schon ein Dutzend andere Blätter, aber bereits nach dem ersten Absatz drückte sich langsam ihr Kreuz durch und ihre Finger fingen an zu zittern. Wie vor den Kopf geschlagen begann sie noch einmal von vorn zu lesen.
Jeder andere, nur er nicht. Lieber Gott, bloß er nicht!
Sie schuldete John Rafferty hunderttausend Dollar.
Plus Zinsen, versteht sich. Zu welchem Zinssatz? Unfähig weiterzulesen, ließ sie das Blatt auf den mit Papieren übersäten Schreibtisch flattern und sank in den abgeschabten alten Ledersessel ihres Vaters, wobei sie die Augen schloss, um gegen die in ihr aufsteigende Übelkeit anzukämpfen. Dabei war sie schon am Boden, aber diese Schulden, mit denen sie nicht gerechnet hatte, machten sie endgültig fertig.
Warum nur musste es ausgerechnet John Rafferty sein? Warum nicht irgendeine Bank? Im Endergebnis wäre es natürlich auf das Gleiche hinausgelaufen, aber wenigstens ohne Demütigung. Allein bei der Vorstellung, ihm gegenübertreten zu müssen, fühlte sie sich klein und verletzlich. Wenn Rafferty diese Verletzlichkeit je entdeckte, war sie verloren. Dann hatte sie keine Chance mehr.
Sie streckte die immer noch zitternden Finger erneut nach dem Blatt aus, um es noch einmal gründlicher zu lesen. John Rafferty hatte ihrem Vater Langley Cabot hunderttausend Dollar geliehen, zuzüglich zwei Prozent Zinsen, was niedriger als der offizielle Zinssatz war … und der Fälligkeitstermin war seit vier Monaten überschritten. Sie fühlte sich immer elender. Sie wusste, dass dieses Geld noch nicht zurückgezahlt worden war, weil sie in dem Bemühen, Ordnung in das finanzielle Chaos zu bringen, das ihr Vater bei seinem Tod hinterlassen hatte, alle Bücher und Unterlagen sorgfältig durchgegangen war. Sie hatte fast ihre gesamte Habe verkauft, um die Schulden zu begleichen, alles bis auf diese Ranch, die der Traum ihres Vaters gewesen und für sie selbst in letzter Zeit zu einem Zufluchtsort geworden war. Als ihr Vater vor zehn Jahren das Haus in Connecticut, in dem sie gelebt hatten, aufgegeben und sich diese Viehranch im schwülen Zentralflorida gekauft hatte, hatte sie Florida nicht gemocht. Aber seitdem war vieles anders geworden. Die Zeiten hatten sich geändert … und die Leute mit ihnen. Im Gegensatz zu ihrem Vater hatte sie nie davon geträumt, eine Ranch zu besitzen, und sie liebte diese Ranch auch nicht, aber sie war schlicht alles, was ihr geblieben war. Früher war ihr das Leben so kompliziert erschienen, doch erstaunlich, wie klar die Dinge waren, wenn es ums nackte Überleben ging.
Es fiel ihr schwer, einfach aufzugeben und dem Unvermeidlichen seinen Lauf zu lassen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass es praktisch unmöglich war, die Ranch nicht nur zu halten, sondern auch noch Gewinn zu erwirtschaften, aber sie war wild entschlossen gewesen, es wenigstens zu versuchen. Weil sie es sich nie hätte verzeihen können, wenn sie den Weg des geringsten Widerstands gegangen wäre und die Ranch einfach verkauft hätte.
Aber jetzt würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als zu verkaufen, zumindest das Vieh. Einen anderen Weg gab es nicht, um diese hunderttausend Dollar zurückzuzahlen. Obwohl es ein Wunder war, dass Rafferty sein Geld bis jetzt noch nicht verlangt hatte. Aber wenn sie das Vieh verkaufte, was wollte sie dann noch mit der Ranch? Sie lebte davon, dass sie von Zeit zu Zeit ein Stück Vieh verkaufte, und wenn dieses Einkommen wegfiel, musste sie die Ranch sowieso aufgeben.
Ein Gedanke, der wehtat, da sie mittlerweile schon zaghaft angefangen hatte zu hoffen, dass sie sie vielleicht doch behalten könnte. Aber jetzt begann dieser winzige Hoffnungsschimmer auch noch zu verschwinden. Was bedeutete, dass sie wieder einmal versagt hatte, so wie sie in ihrem Leben stets versagt hatte: als Tochter, als Ehefrau und jetzt als Rancherin. Selbst wenn Rafferty ihr noch einen kurzen Aufschub gewährte – wovon nicht auszugehen war – war es wenig realistisch zu hoffen, dass sie das Geld später leichter zurückzahlen könnte. Die harte Wahrheit war, dass sie das Geld weder jetzt noch später hatte.
Gut, aber dadurch, dass sie es aufschob, war nichts gewonnen. Sie musste mit Rafferty reden, und da sie keine andere Wahl hatte, konnte sie es genauso gut gleich machen. Es war jetzt kurz vor halb zehn; Rafferty würde bestimmt noch auf sein. Sie suchte seine Nummer heraus und wählte, dann setzte ihre übliche Reaktion ein. Noch bevor das erste Klingelzeichen ertönte, legten sich ihre Finger so fest um den Hörer, dass ihre Knöchel weiß wurden, und ihr Herz begann zu hämmern, als ob sie schnell gerannt wäre. Ihr Magen zog sich vor Anspannung zusammen. Verdammt! Sie würde keinen einzigen zusammenhängenden Satz herausbringen, wenn sie sich nicht in den Griff bekam.
Als nach dem sechsten Läuten die Haushälterin an den Apparat kam, war Michelles Stimme absolut ruhig und kühl, als sie nach Rafferty fragte.
„Tut mir leid, er ist im Moment nicht zu Hause. Kann ich irgendetwas ausrichten?“
Wenn sie nicht gewusst hätte, dass sie jetzt alles noch einmal durchmachen musste, hätte sie es als eine Art Begnadigung empfunden. „Richten Sie ihm bitte aus, dass er Michelle Cabot anrufen soll“, sagte sie und nannte der Haushälterin ihre Telefonnummer. Dann fragte sie: „Kommt er bald zurück?“
Da war ein leichtes Zögern, bevor die Haushälterin sagte: „Nein, wahrscheinlich wird es spät, aber ich werde es ihm gleich morgen früh ausrichten.“
„Danke“, sagte Michelle und legte auf. Sie hätte sich natürlich gleich denken können, dass er unterwegs war. Rafferty war für seine zahllosen Frauenaffären berühmt oder besser gesagt berüchtigt. Dass er mit zunehmendem Alter ruhiger geworden war, konnte man nicht behaupten, zumindest nicht dem Klatsch nach zu urteilen, der über ihn im Umlauf war. Ein Blick aus diesen harten dunklen Augen ließ den Puls einer jeden Frau, die er ansah, schneller schlagen, und er sah eine Menge Frauen an, aber Michelle gehörte nicht dazu. Als sie und Rafferty sich vor zehn Jahren kennengelernt hatten, lag auf den ersten Blick Feindseligkeit zwischen ihnen, und ihre Beziehung ließ sich bestenfalls als Waffenstillstand bezeichnen. Ihr Vater war früher ein Puffer zwischen ihnen gewesen, aber nachdem er jetzt tot war, befürchtete sie das Schlimmste. Rafferty gab sich nicht mit halben Sachen zufrieden.
Da sie wegen der Schulden heute Abend nichts mehr unternehmen konnte und ihr die Lust, noch weiter in den Sachen ihres Vaters herumzukramen, gründlich vergangen war, beschloss sie, ins Bett zu gehen. Sie duschte nur kurz, obwohl sich ihre schmerzenden Muskeln nach einer längeren Dusche gesehnt hätten, aber sie musste an allen Ecken und Enden sparen, auch bei der Stromrechnung.
Als sie schließlich im Bett lag, bekam sie kein Auge zu, obwohl sie todmüde war. Sie musste ständig an das vor ihr liegende Gespräch mit Rafferty denken, und dabei fing ihr Herz sofort wieder an, schneller zu klopfen. Sie versuchte sich zu beruhigen, indem sie tief und langsam durchatmete. So war es schon immer gewesen, und jetzt, wo sie gezwungen war, ihm gegenüberzutreten, war es sogar noch schlimmer. Wenn er bloß nicht so groß wäre! Aber er war über eins neunzig und ungefähr hundert Kilo schiere männliche Muskelkraft, was zur Folge hatte, dass sich jeder andere neben ihm wie ein Zwerg vorkam. In seiner Nähe fühlte sich Michelle immer auf eine elementare Art und Weise bedroht, und jetzt bekam sie schon allein bei dem Gedanken, als Bittstellerin vor ihm zu stehen, Zustände. Bei keinem anderen Mann hatte sie jemals so reagiert; niemand sonst konnte sie so wütend machen, so wachsam – oder sie auf eine seltsam animalische Art und Weise derart erregen.
Und so war es von ihrer ersten Begegnung an gewesen. Sie war damals achtzehn gewesen, verwöhnt und so hochnäsig wie es ein Teenager, der auf seiner Würde beharrte, nur sein konnte. Damals hatte er seinen Ruf schon weggehabt, und Michelle war entschlossen gewesen, ihm im Unterschied zu all den anderen Frauen, die ihn anhimmelten, die kalte Schulter zu zeigen. Als ob er sich für einen Teenager interessiert hätte! dachte sie trocken, während sie sich ruhelos im Bett herumwälzte. Was für ein Kind sie doch gewesen war. Ein dummes, verwöhntes, verunsichertes Kind.
John Rafferty hatte ihr Angst gemacht, auch wenn sie praktisch Luft für ihn gewesen war. Oder besser gesagt war es ihre Reaktion auf ihn gewesen, die ihr Angst gemacht hatte. Er war damals sechsundzwanzig gewesen – ein Mann im Unterschied zu den Jungs, mit denen sie geflirtet hatte, und zwar ein Mann, der es in seinem Alter bereits geschafft hatte, durch jahrelange harte Arbeit eine kleine Ranch in ein blühendes Unternehmen zu verwandeln. Selbst heute konnte sie sich noch ganz genau daran erinnern, wie ihr, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, die Luft weggeblieben war.
Bis dahin hatte sie ihn nur vom Hörensagen gekannt. Wenn die Rede auf ihn kam, nannten ihn die Männer bewundernd einen Zuchthengst. Wenn eine Frau zum ersten Mal mit ihm ausging, mochte man vielleicht noch zu ihren Gunsten entscheiden, aber beim zweiten Mal war ausgemacht, dass sie bereit war, mit ihm ins Bett zu gehen. Damals hatte Michelle keine Sekunde daran gezweifelt, dass das, was man sich über ihn erzählte, stimmte. Und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Rafferty hatte etwas an sich, das jede Mär, die über ihn in Umlauf war, wahrscheinlich machte.
Und dennoch war sie nicht auf den wirklichen Mann vorbereitet gewesen, auf die ungeheure Kraft und Energie, die er ausstrahlte. In manchen Menschen brannte die Lebenskerze heißer und heller als in anderen, und John Rafferty war einer von ihnen. Er war wie ein Mensch, der seine Umgebung mit seiner schieren Größe ebenso wie mit seiner eindrucksvollen, aber auch rücksichtslosen Persönlichkeit einschüchterte.
Sie hatten sich bei ihrer ersten Begegnung auf dem falschen Fuß erwischt, und daran hatte sich seitdem nie mehr etwas geändert. Michelle war wahrscheinlich die einzige Frau auf der Welt, die mit Rafferty im Streit lag, und selbst jetzt war sie sich nicht sicher, ob sie sich wünschte, dass es anders wäre. Irgendwie verschaffte ihr die Gewissheit, dass er sie nicht mochte, Sicherheit, weil es sie immerhin davor bewahrte, von ihm mit diesem umwerfenden Charme überschüttet zu werden.
Sie erschauerte, während sie im Bett lag und über das nachdachte, was sie bis jetzt nur sich selbst einzugestehen gewagt hatte: Sie war Rafferty gegenüber genauso wenig immun wie die Legionen von Frauen, die sich ihm bereits ergeben hatten. Sie war nur so lange vor ihm sicher, wie er nicht mitbekam, wie verletzlich sie ihm gegenüber war. Falls es ihm klar würde, würde er seine Macht genüsslich ausspielen und sie für jede einzelne ihrer verletzenden Bemerkungen büßen lassen. Um sich selbst vor ihm zu schützen, musste sie ihn sich mit Feindseligkeiten vom Leib halten; ein Umstand, den man jetzt, wo sie auf sein Wohlwollen angewiesen war, wenn sie finanziell überleben wollte, nur als Ironie des Schicksals bezeichnen konnte.
Sie hatte im Lauf der Zeit fast vergessen, wie es sich anfühlte, wenn man ganz normal und unaffektiert lachte, aber jetzt spürte sie, wie sich in der Dunkelheit ihres Schlafzimmers ihre Lippen zu einem trockenen Grinsen verzogen. Wenn ihr Überleben allein von Raffertys Menschenfreundlichkeit abhing, sollte sie sich besser gleich selbst auf der Weide ein tiefes Loch graben und sich mit Dreck bedecken – das würde ihm eine Menge Zeit und Mühe ersparen.
Am nächsten Tag blieb sie so lange wie möglich im Haus und wartete auf seinen Anruf, aber da sie jede Menge Arbeit hatte, gab sie es irgendwann auf. Sie ging in die Scheune, in Gedanken bereits mit den Tausenden von Problemen beschäftigt, die die Ranch jeden Tag für sie bereithielt. Mehrere Wiesen mussten gemäht werden, und anschließend musste das Heu zu Ballen verpackt werden, doch da sie gezwungen gewesen war, den Traktor und die Heubündelmaschine zu verkaufen, blieb ihr jetzt nur noch die Möglichkeit, demjenigen, der ihr die Arbeit abnahm, für seine Dienste die Hälfte des Heus anzubieten. Sie fuhr mit dem Pick-up rückwärts in die Scheune und stieg dann auf den Heuboden, um ihre rapide dahinschwindenden Heuballen zu zählen. Sie würde bald irgendetwas unternehmen müssen.
Weil es ihr unmöglich war, die schweren Ballen hochzuheben, hatte sie ihr eigenes System entwickelt, um mit diesem Problem fertig zu werden. Sie hatte den Pick-up direkt unter der Luke zum Heuboden abgestellt, sodass sie die Ballen nur noch durch die Luke stoßen musste, damit sie auf der Laderampe des Pick-ups landeten. Das zu bewerkstelligen war jedoch nicht ganz einfach, immerhin war so ein Ballen an die hundert Pfund schwer und damit nur geringfügig leichter als sie selbst. Das Gewicht der Ballen variierte, aber manche davon waren so schwer, dass sie sie keinen Zentimeter von der Stelle bekam.
Sie fuhr mit dem Truck auf die Weide, wo die Rinder grasten. Köpfe hoben sich, dunkelbraune Augen schauten dem Truck entgegen, und gleich darauf setzte sich die ganze Herde in Bewegung und kam auf sie zu. Michelle hielt an und kletterte nach hinten auf die Ladefläche. Sie schnitt einen Ballen auf und verteilte das Heu mit einer Heugabel auf der Ladefläche, dann spießte sie es auf und warf es nach unten. Gleich darauf setzte sie sich wieder hinters Steuer, fuhr ein Stück weiter und wiederholte dort die Prozedur mit dem nächsten Ballen. Das machte sie so lange, bis die Ladefläche leer war, und als sie endlich fertig war, brannten ihre Nacken- und Schultermuskeln wie Feuer.
Glücklicherweise waren es inzwischen längst nicht mehr so viele Rinder wie früher, sonst hätte sie es gar nicht geschafft. Obwohl sie sich, wenn die Herde größer gewesen wäre, wenigstens eine Hilfskraft hätte leisten können. Als sie daran dachte, wie viele Hände früher dazu beigetragen hatten, die Ranch instand zu halten, stieg tiefe Niedergeschlagenheit in ihr auf. Ihr Verstand sagte ihr, dass sie das allein unmöglich alles schaffen konnte.
Und was nutzte ihr eine solche Überlegung? Sie musste es allein schaffen, weil sie sonst niemanden hatte. Manchmal dachte sie, dass das anscheinend die Lektion war, die das Leben entschlossen war, ihr zu erteilen: dass sie sich nur auf sich selbst verlassen konnte, dass es niemanden gab, dem sie vertrauen konnte, niemanden, an den sie sich anlehnen konnte, niemanden, der stark genug war, um sie festzuhalten, wenn sie sich ausruhen musste. Es hatte in ihrem Leben Zeiten gegeben, in denen sie sich schrecklich einsam gefühlt hatte, vor allem, seit ihr Vater gestorben war, obwohl sie gleichzeitig eine fast perverse Befriedigung verspürte, dass ihr jetzt gar nichts anderes mehr übrig blieb, als sich nur noch auf sich selbst zu verlassen. Da sie von anderen Menschen nichts erwartete, konnte sie auch nicht enttäuscht werden. Sie nahm die Dinge so, wie sie kamen, ohne sie sich schönzureden, tat, was getan werden musste, und machte von da aus weiter. Immerhin war sie im Gegensatz zu früher jetzt frei.
Sie stapfte auf der Ranch herum und machte ihre Arbeit, wobei sie an rein gar nichts dachte und einfach nur die inzwischen schon gewohnten Bewegungen mechanisch ausführte. Es fiel ihr leichter so, und wenn sie mit der Arbeit fertig war, konnte sie ihren diversen Wehwehchen immer noch genug Aufmerksamkeit zukommen lassen. Keiner ihrer alten Freunde hätte es je für möglich gehalten, dass Michelle Cabot sich jemals bei harter Rancharbeit ihre zarten Hände schmutzig machen könnte. Manchmal malte sie sich genüsslich aus, was sie wohl dazu sagen würden. Sie war immer für eine Party, einen ausgedehnten Einkaufsbummel, eine Reise nach St. Moritz oder eine Kreuzfahrt auf irgendjemandes Yacht zu haben gewesen. Sie hatte stets gelacht und vor geistreichen Bemerkungen nur so gesprüht. Mit einem Glas Champagner in der Hand und Brillanten im Ohr war sie das typische Partygirl gewesen.
Schön, und jetzt musste das Partygirl eben Vieh füttern, Gras mähen und Zäune reparieren, und das war nur die Spitze des Eisbergs. Sie musste die Rinder brandmarken, aber wie sie das allein schaffen sollte, war ihr schleierhaft. Und dann blieben noch das Kastrieren, das Impfen und die Aufzucht … Wenn sie es sich erlaubte, über alles, was getan werden musste, nachzudenken, versank sie in Hoffnungslosigkeit, sodass sie jeden Gedanken daran normalerweise weit wegschob. Sie nahm die Tage, wie sie kamen, biss sich so gut wie möglich durch und tat, was sie tun konnte. Es war eine Überlebensstrategie, die sie mittlerweile ziemlich gut beherrschte.
Nachdem sich Rafferty um zehn Uhr abends immer noch nicht gemeldet hatte, gab sie sich einen Ruck und rief noch einmal bei ihm an. Als wieder die Haushälterin am Apparat war, unterdrückte Michelle ein verärgertes Aufseufzen und fragte sich, ob Rafferty überhaupt jemals auch nur eine einzige Nacht zu Hause verbrachte. „Hier ist Michelle Cabot. Ich würde gern mit Rafferty sprechen. Ist er da?“
„Er ist gerade im Stall. Moment, ich stelle Sie zu ihm durch.“
Dann hatte er also im Stall Telefon. Während sie dem Rauschen in ihrem Ohr lauschte, dachte sie einen Moment lang voller Neid an seine gut funktionierende große Ranch, die bestimmt eine Menge Gewinn abwarf.
Als er mit seiner tiefen Stimme seinen Namen bellte, schrak sie zusammen und schloss, den Hörer fest umklammernd, die Augen.
„Hier ist Michelle Cabot“, meldete sie sich so kühl und distanziert, wie sie konnte. „Wenn Sie einen Moment Zeit haben, würde ich gern etwas mit Ihnen besprechen.“
„Im Augenblick passt es mir überhaupt nicht. Eine Stute fohlt gerade, also fassen Sie sich kurz.“
„So kurz geht es auch wieder nicht. Könnte ich dann vielleicht einen Termin mit Ihnen vereinbaren? Wie wäre es, wenn ich morgen Vormittag bei Ihnen vorbeikomme?“
Er lachte trocken und humorlos auf. „Das hier ist eine Ranch, auf der hart gearbeitet wird, und kein Amüsierbetrieb, Herzchen. Morgen Vormittag geht es nicht.“
„Wann dann?“
Er fluchte ungehalten in sich hinein. „Hören Sie, vor allem habe ich jetzt keine Zeit. Ich komme morgen Abend bei Ihnen vorbei. So gegen sechs.“ Ohne ihre Zustimmung abzuwarten, legte er auf, während sie sich niedergeschlagen sagte, dass er jetzt eben derjenige war, der den Ton angab, von daher spielte es wirklich keine Rolle, ob ihr die Zeit passte oder nicht. Jetzt hatte sie den Anruf wenigstens hinter sich, und ihr blieben noch fast zwanzig Stunden, um sich für das Zusammentreffen mit ihm zu wappnen. Sie würde morgen rechtzeitig mit der Arbeit Schluss machen, damit sie sich noch duschen und die Haare waschen konnte, sie würde Make-up und Parfüm auflegen und die weiße Leinenhose mit der weißen Seidenbluse anziehen. Und wenn Rafferty sie dann anschaute, würde er genau das in ihr sehen, wofür er sie immer gehalten hatte: eine verwöhnte und nutzlose Person.
Es war später Nachmittag, die Sonne knallte schon den ganzen Tag vom Himmel, sodass das Thermometer auf achtunddreißig Grad im Schatten geklettert war, und das Vieh war nervös. Rafferty war verschwitzt, schmutzig und mies gelaunt, und seinen Männern ging es nicht anders. Sie hatten zu lange gebraucht, um die Rinder einzufangen, sodass sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft hatten, sie alle zu kennzeichnen und zu impfen, und jetzt kündigte ein tiefes Donnergrollen das Heraufziehen eines Sommergewitters an. Die Männer beeilten sich mit ihrer Arbeit, weil sie fertig werden wollten, ehe das Unwetter losbrach.
Staub wirbelte durch die Luft, während die Nervosität stieg und sich der durchdringende Gestank versengten Fleischs verstärkte. Rafferty, der sich für keine Arbeit zu schade war, arbeitete mit seinen Männern Hand in Hand. Es war immerhin seine Ranch, sein Leben. Die Arbeit war schwer und schmutzig, aber er hatte seine Ranch profitabel gemacht, während andere Ranchs untergegangen waren, und das hatte er mit seiner eigenen Hände Arbeit und eiserner Entschlossenheit erreicht. Weil sein Vater es nicht geschafft hatte, seiner Mutter das Leben zu bieten, das sie sich erträumt hatte, hatte sie Mann und Sohn sitzen gelassen. Aber natürlich war die Ranch damals noch viel kleiner gewesen als heute, und manchmal zog Rafferty eine grimmige Genugtuung aus der Tatsache, dass seine Mutter ihr Fortgehen mittlerweile bitter bereute. Er hasste sie nicht; er wollte nur nicht allzu viel Zeit und Mühe mit ihr verschwenden. Er hatte einfach keine Verwendung für sie oder die anderen reichen, verwöhnten, gelangweilten, nichtsnutzigen Leute, die sie ihre Freunde nannte.
Nev Luther, der über ein Kalb gebeugt dastand, richtete sich auf, wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn und schaute blinzelnd in die Sonne, hinter der eine schwarze Wolkenbank heraufzog. „Okay, das hätten wir“, brummte er. „Wir sollten besser aufladen, bevor es losgeht.“ Dann schaute er seinen Boss an. „Was ist, fahren Sie heute noch zu der kleinen Cabot raus?“
Nev war im Stall gewesen, während Rafferty mit Michelle geredet hatte, und hatte die Unterhaltung mitbekommen. Nach einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr fluchte Rafferty laut. Er hatte sie völlig vergessen und war Nev nicht dankbar dafür, dass er ihn an sie erinnerte. Es gab nur wenige Menschen, die ihn mehr ärgerten als Michelle Cabot.
„Mist, ich muss los“, brummte er widerstrebend. Er konnte sich schon denken, was sie von ihm wollte. Obwohl er überrascht gewesen war, dass sie von sich aus angerufen hatte. Wahrscheinlich wollte sie ihm nur die Ohren volljammern, dass sie kein Geld hatte. Allein bei dem Gedanken hätte er sie am liebsten gepackt und geschüttelt. Sie war genau das, was er am meisten verabscheute: ein Parasit, verwöhnt und egoistisch, hatte noch nie in ihrem Leben auch nur einen einzigen Tag richtig gearbeitet. Ihr Vater hatte sich in den selbst verschuldeten Ruin getrieben, indem er ihr jede Bitte von den Augen abgelesen hatte, aber Langley Cabot war schon immer ein absoluter Schwachkopf gewesen, wenn es um seine einzige heiß geliebte Tochter ging. Für seine kleine Michelle war ihm absolut nichts zu teuer gewesen.
Zu schade nur, dass diese geliebte Michelle so ein verwöhntes Gör war. Verdammt, sie machte ihn wirklich rasend. Sie hatte ihn vom ersten Moment an rasend gemacht, als sie, so etepetete wirkend, auf ihn zugekommen war, die Nase hoch in der Luft, als ob sie irgendetwas Schlechtes röche. Nun, vielleicht hatte sie das ja. Schweißgeruch, hervorgebracht von harter körperlicher Arbeit, war ein unbekannter Geruch für sie. Sie hatte ihn wie einen Wurm angeschaut und ihm gleich darauf desinteressiert den Rücken gekehrt, während sie versucht hatte, ihrem Vater wieder einmal irgendetwas abzuschwatzen.
„Also, Boss, wenn Sie keine Lust haben, zu dieser flotten Puppe rauszufahren, kann ich es ja für Sie übernehmen“, sagte Luther grinsend.
„Klingt gut“, sagte Rafferty mürrisch und schaute wieder auf seine Uhr. Er konnte noch nach Hause fahren und duschen, aber dann würde er viel zu spät kommen. Er war im Moment nicht weit von der Cabot-Ranch entfernt, und er hatte keine Lust, jetzt erst den ganzen Weg nach Hause zu fahren, um kurz darauf dieselbe Strecke noch einmal zurückzulegen, nur damit ihre empfindsame Nase nicht beleidigt wurde. Sie musste sich schon damit abfinden, wie er war; immerhin war sie es ja, die etwas von ihm wollte. Er war genau in der richtigen Stimmung, auf der sofortigen Rückzahlung der Schulden zu bestehen, auch wenn er ganz genau wusste, dass sie pleite war. Er fragte sich mit beißendem Spott, ob sie ihm vielleicht anbieten wollte, ihn auf andere Weise zu bezahlen. Und dann würde es ihr nur recht geschehen, wenn er mitspielte, weil sie sich schon allein bei der bloßen Vorstellung, ihm ihren gut gepflegten Körper zu überlassen, vor Abscheu winden würde. Immerhin war er ungehobelt und schmutzig und arbeitete für seinen Lebensunterhalt.
Während er zu seinem Truck hinüberschlenderte und seine langen Beine unter dem Lenkrad verstaute, konnte er es nicht verhindern, dass ihm ein Bild durch den Kopf schoss. Er sah Michelle Cabot unter sich liegend, der schlanke Körper nackt, das hellblonde Haar wie ein Fächer auf seinem Kissen ausgebreitet, während er sich in ihr bewegte. Er spürte, dass seine Hose bei dieser Vorstellung eng wurde, und fluchte leise in sich hinein. Er begehrte Michelle Cabot seit zehn Jahren, und gleichzeitig wollte er ihr auf jede nur erdenkliche Weise ihren verdammten Snobismus austreiben.
Andere sahen sie nicht so wie er. Wenn sie es darauf anlegte, konnte sie durchaus charmant sein und die Leute um den kleinen Finger wickeln, wahrscheinlich nur, um sich anschließend über sie lustig zu machen. Die Rancher und Farmer hier in der Gegend waren freundliche Leute, die sich selbst für die harte Arbeit belohnten, indem sie fast jedes Wochenende irgendwelche Grillpartys veranstalteten, und sie fraßen Michelle alle aus der Hand. Sie lachte und scherzte und tanzte mit allen … außer mit ihm. Sie würde mit jedem Mann tanzen, nur nicht mit ihm. Er hatte sie beobachtet, zugegeben, und weil er ein ganz normaler Mann mit einem gesunden Geschlechtstrieb war, war es nur natürlich gewesen, dass er auf diesen biegsamen, schlanken, kurvenreichen Körper und dieses strahlende Lächeln körperlich reagiert hatte, auch wenn es ihn ärgerte. Er wollte sie nicht begehren, aber jedes Mal, wenn er sie anschaute, stieg Verlangen in ihm auf.
Andere Männer hatten sie auch schon begehrt, Mike Webster zum Beispiel konnte ein Lied davon singen. Rafferty konnte sich nicht vorstellen, ihr je verzeihen zu können, was sie Mike angetan hatte, in dessen Ehe schon einiges schiefgelaufen war, bevor Michelle mit ihrem perlenden Lachen auf der Bildfläche erschienen war und allen Männern den Kopf verdreht hatte. Mike war ihr nicht ebenbürtig gewesen und war hart und tief gefallen, und seine Ehe war anschließend nicht mehr zu retten gewesen. Dann hatte Michelle nach einem neuen Opfer Ausschau gehalten, und Mike war mit einem ruinierten Leben auf der Strecke geblieben. Der junge Rancher hatte alles verloren, wofür er gearbeitet hatte, weil ihn seine Scheidung so teuer gekommen war, dass er seine Ranch hatte verkaufen müssen. Er war nur ein Mann mehr, den Michelle mit ihrem Egoismus ruiniert hatte, ebenso wie ihren Vater. Auch als Langley das Wasser schon bis zum Hals gestanden hatte, hatte er doch immer von irgendwoher das Geld für Michelles verschwenderischen Lebensstil aufgetrieben. Ihr Vater war untergegangen, aber sie beharrte immer noch auf Seide und teurem Schmuck und Skiurlauben. Das musste schon ein reicher Mann sein, der sich Michelle Cabot leisten konnte, und stark sein musste er obendrein.
Der Gedanke, dass er derjenige sein könnte, der sie mit diesen Dingen versorgte und der Einzige, der deshalb gewisse Rechte auf sie hatte, ging ihm nicht aus dem Kopf. Egal, wie sehr sie ihn mit ihrem Gehabe auch anwiderte, schaffte er es doch nicht, seine körperliche Reaktion auf sie in den Griff zu bekommen. Sie hatte etwas, das in ihm den brennenden Wunsch erweckte, die Hand nach ihr auszustrecken und sie zu nehmen. Sie sah teuer aus, sie klang und duftete teuer, und er wollte unbedingt wissen, ob sie auch so teuer schmeckte, ob ihre Haut wirklich so samtig war. Er wollte seine Hände in ihr seidiges Haar wühlen und ihren großen, weichen Mund schmecken, ihr mit den Fingerspitzen über die gemeißelte Perfektion ihrer Wangenknochen fahren und den erregenden Duft ihrer Haut tief einatmen. Er hatte am ersten Tag, an dem er sie kennengelernt hatte, den Duft ihres Parfüms, vermischt mit dem Duft ihrer Haut und der Süße ihres Fleischs darunter gerochen. Gut, sie war teuer, zu teuer für Mike Webster und den armen Trottel, den sie geheiratet und dann sitzen gelassen hatte, und für ihren Vater war sie erst recht zu teuer gewesen. Und doch wollte sich Rafferty in all dieser Fülle verlieren. Vielleicht war Michelle eine Plage, aber sie sandte alle richtigen Signale aus, um die Männer anzulocken wie eine süß duftende Blume die Bienen.
Im Augenblick hatte Michelle keinen Förderer, aber er wusste, dass der nächste Mann nicht lange auf sich warten lassen würde. Und warum sollte nicht er dieser Mann sein? Er hatte es satt, sie zu begehren und mit ansehen zu müssen, wie sie hochnäsig durch ihn hindurchschaute. Ihn würde sie nicht um den kleinen Finger wickeln können, so wie sie es gewohnt war, aber das würde ihr recht geschehen. Rafferty starrte mit zusammengekniffenen Augen durch den Regen, der gegen die Windschutzscheibe pladderte, und malte sich genüsslich aus, wie es sein würde, wenn Michelle ganz und gar von ihm abhängig wäre. Bei diesem Gedanken stieg ein Gefühl tiefer Genugtuung in ihm auf. Er würde sie benutzen, seinen sexuellen Heißhunger an ihr stillen, aber er würde es zu verhindern wissen, dass sie ihm den Verstand benebelte.