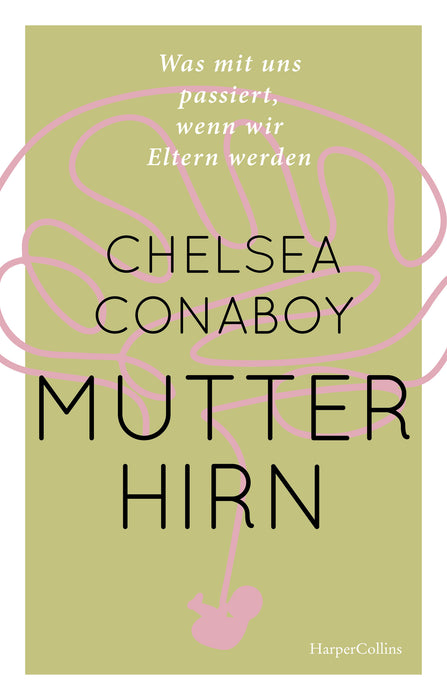
Mutterhirn. Was mit uns passiert, wenn wir Eltern werden
EIN KIND ÄNDERT ALLES – aber was eigentlich genau?
Ein Kind ändert alles. Viele Eltern hören diese Worte, doch was dahintersteht, darüber wird meist geschwiegen. Der ominöse Baby-Blues soll nach der Geburt rasch verklingen, und dank Mutterinstinkt wird die vergessliche Mama das Kind schon schaukeln. Doch was wissen wir tatsächlich über die Veränderungen, die unser Gehirn in der Schwangerschaft, der Geburt und der turbulenten Zeit danach erfährt?
In ihrem Buch belegt die preisgekrönte Journalistin Chelsea Conaboy, selbst zweifache Mutter, wie weit viele Verklärungen der Elternschaft an der Realität vorbeigehen. Aus einer Geburt geht nicht nur ein neuer Mensch hervor, sondern mindestens zwei. Eltern durchlaufen eine Entwicklungsphase, die Neurobiologen mit der Pubertät vergleichen.
Anhand aktueller Studien und Gesprächen mit renommierten Wissenschaftlern liefert die Autorin uns einen Einblick in ein faszinierendes Forschungsfeld, das selbst noch in den Kinderschuhen steckt. Was ist es, das Eltern so sonderbar wie besonders macht? Und was fangen wir als Erziehende jetzt damit an? Ein Buch für alle, die auf der Suche nach der Wahrheit hinter dem Mythos Elternschaft sind.

