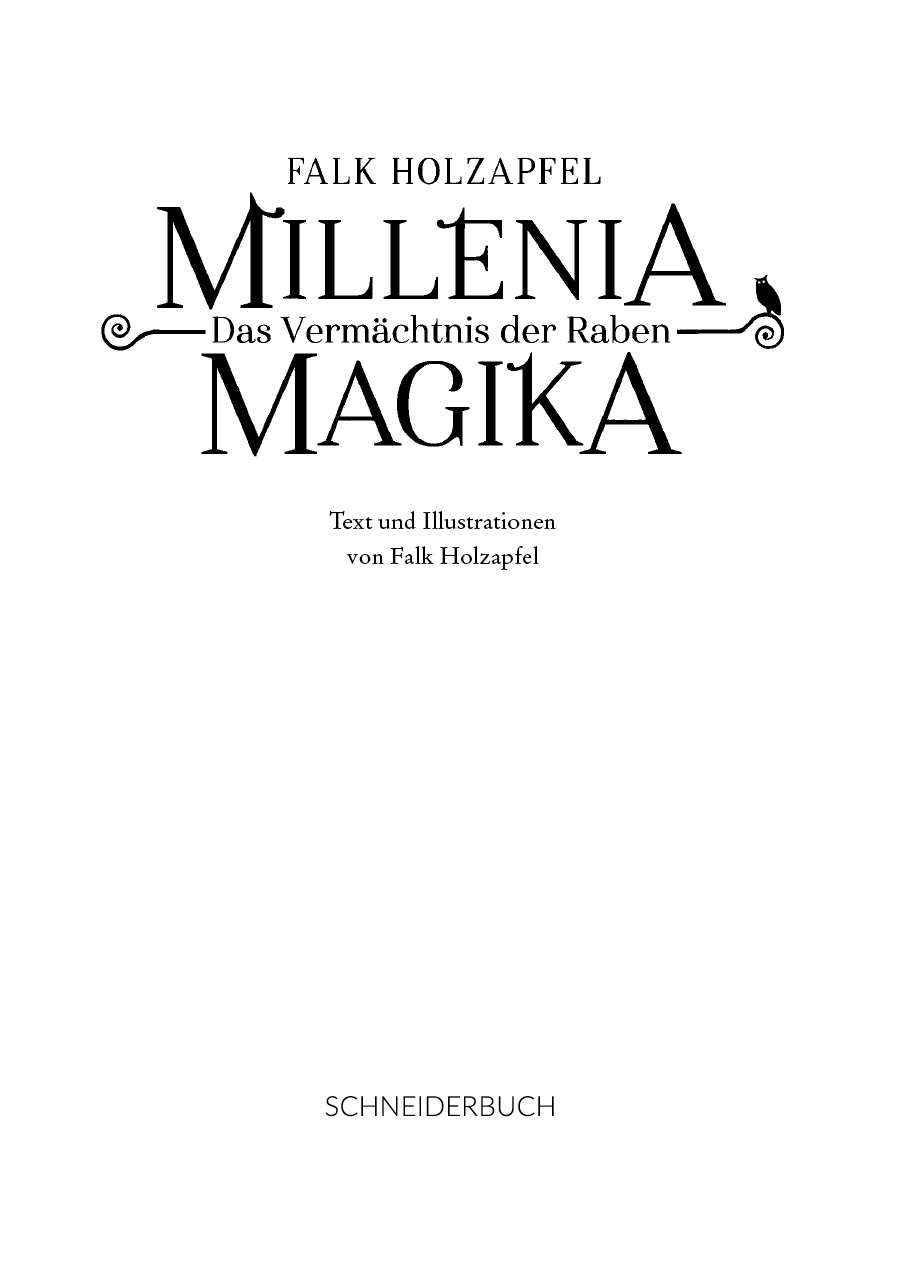Millenia Magika - Das Vermächtnis der Raben
In den Schatten der Vergangenheit lauert ein alter Feind
Endlich ist Adrian dort angekommen, wo er hingehört und wo er sich zu Hause fühlt: in der magischen Stadt Arken. Doch plötzlich erreicht ihn ein dringender Hilferuf aus dem Arkener Forst und es verschwinden überall Kinder. Da man eine übernatürliche Ursache hierfür vermutet, ist Adrian in seiner Funktion als Schamane, der zwischen der Geister- und der Menschenwelt vermitteln kann, gefragt. Er ist sich sicher, dass er die Verbrechen aufklären kann. Doch diesmal ist er ganz auf sich allein gestellt, denn Juri und Jazz sind auf einer geheimnisvollen Mission in der unmagischsten Stadt Deutschlands unterwegs. Während immer mehr Kinder verschwinden, tauchen Hexenjäger in Arken auf und Adrian muss erkennen, dass er das Geheimnis seiner Familie kennen muss, um die Rätsel der Gegenwart zu lösen.
Fesselndes Fantasy-Abenteuer voller Spannung, Humor und Magie