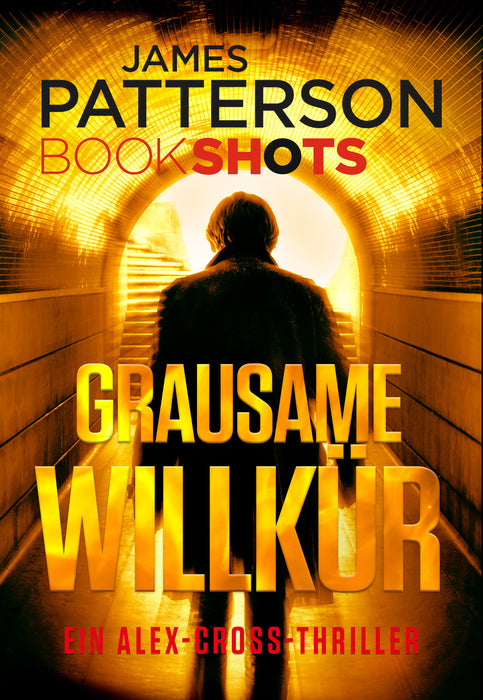
Grausame Willkür
Alex Cross ist routiniert im Lösen von Kriminalfällen. Aber diesmal befindet er sich selbst im Fadenkreuz … Und er hat es scheinbar mit einem Untoten zu tun: Der Mörder Gary Soneji, den Alex vor mehr als zehn Jahren hat sterben sehen, hat Alex Cross‘ Partner niedergeschossen und ist nun hinter ihm her. Ist Soneji doch am Leben? Ist es sein Geist? Als Cross der ersten Spur folgt, die nicht ins Jenseits führt, wird bald klar: Nichts ist so verstörend wie die Wirklichkeit.
"Ich wollte ja nur mal ganz kurz rein lesen. Nur ganz kurz. Aber das ist ja gar nicht möglich. Der Start ist so rasant, so spannend und so fesselnd, das ich meinen Reader gar nicht zur Seite legen mag."
(CWPunkt auf lovelybooks.de)

