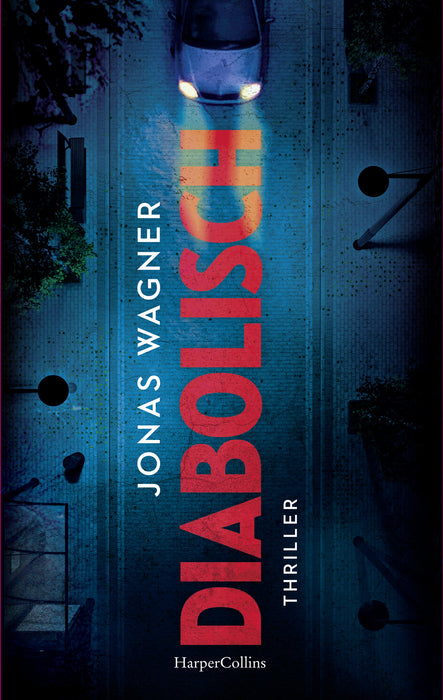
Diabolisch
1995 macht sich der sechsjährige Alex in der Abenddämmerung mit seiner älteren Schwester Lotte allein auf den Heimweg, nachdem die beiden vergeblich darauf gewartet haben, dass ihr Vater sie abholt. Doch nur Lotte wird heil zu Hause ankommen. Auf Alex warten die Eltern vergebens.
Siebenundzwanzig Jahre später geschieht in diesem Dorf eine Reihe von blutigen Verbrechen. Ein Bewohner nach dem anderen muss auf grausame Weise sein Leben lassen. Oberkommissarin Larissa Flaucher versucht, einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen zu rekonstruieren – und stößt auf nicht nur ein monströses Geheimnis.

