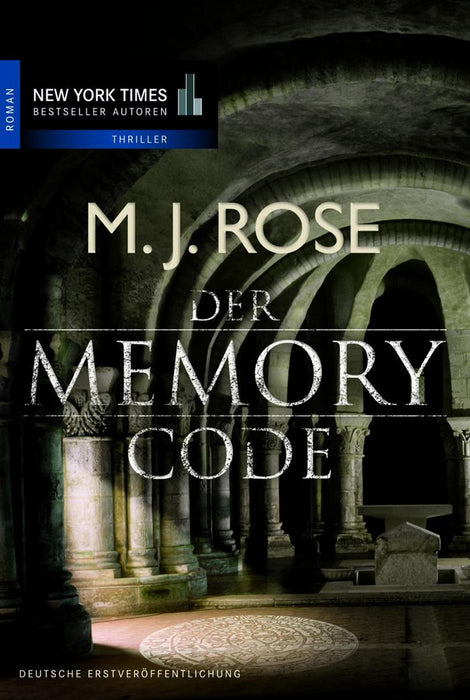
Der Memory Code
Nach einem Bombenanschlag in Rom verfolgen den Fotografen Josh Ryder mysteriöse Visionen. Erinnerungen an ein früheres Leben? Immer wieder versucht er verzweifelt, eine Frau namens Sabina zu retten - und den Schatz, den sie hütet. Aber wer ist Sabina? Seine Recherchen führen Josh auf die Spur der Archäologin Gabriella Chase. Vor Kurzem hat ihr Ausgrabungsteam eine Grabkammer entdeckt, die ein mächtiges Geheimnis birgt: die legendären Memory-Steine, die das Rätsel der Wiedergeburt für immer zu lösen versprechen. Doch Josh und Gabriella wollen nicht als einzige den Code der Steine entschlüsseln. Sie geraten ins Fadenkreuz einer gefährlichen Verschwörung, die auch vor dem Vatikan nicht halt macht. Schon bald müssen sie fürchten, dass sich eine blutige Spur aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart zieht. Und der nächste Mord geschieht ...


