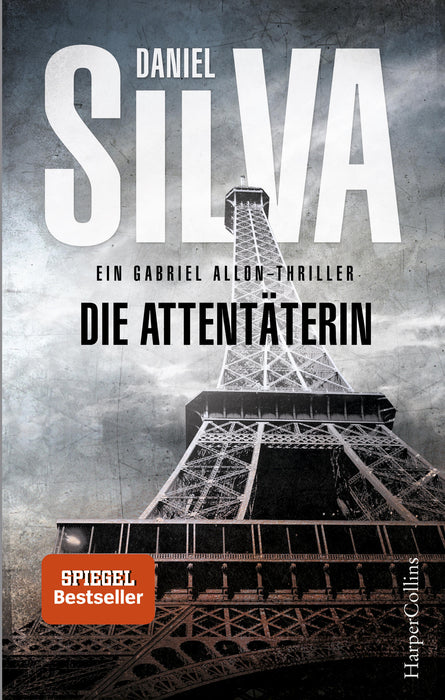
Die Attentäterin
Ein verheerender Bombenanschlag des IS im Pariser Marais-Viertel zwingt Gabriel Allon ein letztes Mal ins Feld: Anstatt seinen Posten als Chef des israelischen Geheimdienstes anzutreten, hilft der legendäre Agent den französischen Behörden, den Drahtzieher des blutigen Terroraktes zu suchen. Außer dessen Namen - Saladin - weiß man nichts über ihn. Allon sieht die einzige Möglichkeit an ihn heranzukommen darin, jemanden in das Terrornetzwerk des IS einzuschleusen. Eine junge Ärztin scheint die perfekte Rekrutin für das gefährliche Unterfangen zu sein …
"‚Die Attentäterin‘ zeigt Daniel Silva in gewohnter Form. 80 kurze Kapitel voll überraschender Wendungen und rasanter Action bieten spannende Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite." dpa
"Realistischer und aktueller geht es nicht." Landeszeitung für die Lüneburger Heide
"Routiniert entwickelt der Bestsellerautor realistische Figuren, deren radikale Denkmuster er glaubhaft wie hautnah vermitteln kann, und steigert die Spannung bis zum dramatischen Finale. Da bleibt nur zu hoffen, dass seine fiktionale Terrorszenarien niemals Realität werden und verdammt gute Unterhaltungsliteratur bleiben." Kulturnews
"Mich hat sowohl das Personal überzeugt als auch die Handlung. Alle Figuren sind für mich stimmig, sie interagieren überzeugend und haben mich von Anfang an in ihren Bann gezogen. Genauso die Handlung, die zwar mutig ist, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie (fast) genau so real passieren kann." Krimimimi
"Von den tatsächlichen Ereignissen beim Schreiben überholt, zeigt der US-Amerikaner einmal mehr, wie nahe er in seinen Büchern der Wirklichkeit kommt. Packend spiegelt ‚Die Attentäterin‘ die komplexen Welten von Geheimdiensten, Spionen und einem global agierenden Terrornetzwerk wider und zeichnet sich dabei neben fundierter Recherche durch facettenreiche Figuren aus, die die Motive aller Charaktere nachvollziehbar machen." Krimi-Tipp
"Personen, Dialoge und Handlungen wirken komplett authentisch - und das ist man von Daniel Silva so gewohnt. Auf manchen Büchern steht nur Thriller drauf - hier ist Spannung auch wirklich drin." Krimi-Couch.de
"Daniel Silva bestätigt seinen Ruf als einer der führenden Autoren von Agententhrillern. Die Seiten blättern sich, wie von selbst." - New York Journal of Books
"Ein literarisches Pulverfass” - The Huffington Post












