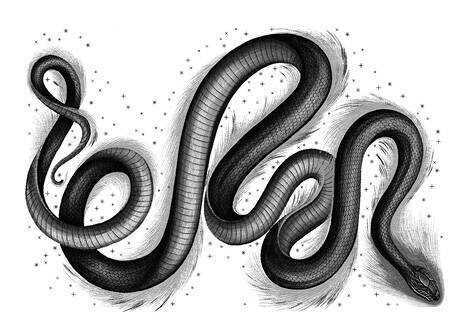Die letzte Erzählerin
Warte nicht auf morgen!
Petra Peña gehört zu den wenigen, die es vor dem unausweichlichen Weltuntergang auf eines der rettenden Schiffe schaffen. Eine Reise ins Ungewisse liegt vor ihr. Jahrhunderte später wacht Petra auf. Das Ziel, ein Planet mit erdähnlichen Bedingungen, scheint erreicht. Aber in der Zwischenzeit ist viel geschehen. Auf dem Raumschiff zählen nur noch Gehorchen und Gleichsein. Und plötzlich ist Petra die Letzte, die sich an die Erde und das Leben dort erinnert. Kann sie mit dem Wissen um die Vergangenheit das Überleben der Menschheit sichern?
»Fesselnd in seinen Twists und bewegend in seinen Themen – wunderschön!« New York Times
»Wunderbar subversiv.« Wall Street Journal
»Eine wunderschön erzählte Geschichte darüber, was uns zu Menschen macht.« Star Tribune
»Ein spannendes und hoffnungsvolles Science-Fiction-Werk.« Boston Globe
»Lehrt junge Leser die Kraft des Geschichtenerzählens.« TIME
»Leserinnen und Leser finden das Versprechen, dass die Vergangenheit nicht der Feind der Zukunft ist, sondern ein Geschenk, das die Perspektive eröffnet, dieser Zukunft mit Mitgefühl und Tapferkeit zu begegnen.« Bookpage